Spiele sind narrative Medien. Seitdem ich vor etwa 20 Jahren mit diesem Hobby angefangen habe, hat sich die Reaktion auf diese Aussage gewandelt. Von augenrollender Ablehnung bis zu vorsichtigen, mit Einschränkungen versehenen Zustimmung, dass es vielleicht, möglicherweise und unter bestimmten Umständen vorstellbar wäre, dass man Spiele als narrative Medien bezeichnen könnte. Nun gibt es viele sorgfältig gewählte, präzise formulierte und aufwändig geschaffene Definitionen für die Begriffe „Spiel“, „narrativ“ und „Medium“ mit denen man die Anfangsaussage so auslegen kann, dass sie für einer Mehrzahl oder Minderheit an Spielen gilt. Aber ich denke der Grund weshalb die meisten Menschen nicht aus dem Bauch heraus zustimmen – so wie sie es etwa bei Büchern oder Filmen tun würden – hat damit zu tun wie Spiele auf uns Einfluß nehmen. Genauer gesagt, welche Art der Gefühle sie aus uns herauslocken können. Bücher sind ein narratives Medium und Literatur kann uns tief empfundene Freude oder Trauer fühlen lassen. Filme sind narrative Medien und im Kino können wir uns in tief empfundener Ehrfrucht oder Angst verlieren. Spiele hingegen machen halt Spaß.
Brettspiele können uns zum Lachen bringen. Manchmal bringen sie uns dazu unser Augen verblüfft und überrascht aufzureißen. Aber sie scheitern daran uns zu Tränen zu rühren. Ich möchte darüber sprechen warum das so ist.

Aber da es sich hier um einen Blogeintrag und kein Buch handelt, werde ich nur zwei Hauptgründe für den augenscheinlichen Mangel an emotionaler Tiefe ansprechen, und warum diese Einschränkungen nicht unüberwindbar sind.
1. Belanglosigkeit
Es gilt als gegeben, dass Spiele bedeutungslos sind. Sie sind, wenn man sie genau betrachtet trivial und irrelevant. Es ist nicht schwer zu verstehen warum dieser Glaube anhält. Der Magische Kreis (Huizinga) ist eine strukturierendes Konzept mit der wir eine Art kleine Realitätsblase erschaffen. Darin gelten neue Regeln und Bräuche und dieser Kreis ist untrennbar mit unserem Verständnis von Spielen verbunden. Die Regeln des Spiels gelten nur innerhalb der Grenzen des Spiels selbst. Sie können nicht darüber hinaus wirken um uns zu verändern, unsere Beziehungen oder sogar die Realität selbst. Sie funktionieren ähnlich wie das Holodeck aus Star Trek – Das Nächste Jahrhundert. Jede phantastische und wunderliche Simulation die darin geschieht, gehorcht bestimmten Regeln der Simulation. Aber sobald man aus ihr heraus tritt, haben die Regeln keine Macht mehr darüber was man tun kann und was nicht. Es ist also vollkommen logisch, dass ein Spiel, welches außerhalb seiner Spieldauer keine bleibende Veränderung bewirken kann, demnach auch belanglos ist, oder?
Ich würde dagegen halten, dass wir hier zwei Dinge gleichsetzen, die zwar verwandt aber nicht identisch sind, oder gar austauschbar. Es ist in diesem Zusammenhang sogar enorm wichtig diese Dinge klar von einander zu trennen. Spiele sind folgenfrei, aber nicht belanglos. Sie sind vorübergehend von Bedeutung während wir sie spielen, aber diese Bedeutsamkeit löst sich schnell auf, sobald wir den Magischen Kreis verlassen, oder unsere intensive Immersion oder unseren „Flow State“ oder wie auch immer man eine fesselnde Spielerfahrung nennen will.

Aber während wir spielen, ist das Spiel für uns von Bedeutung. Denn sonst gäbe es im Spiel auch keine Spannung. Wenn Sieg oder Niederlage uns wirklich egal wären, dann hätte unser Spiel keine Ausrichtung. Es wäre nicht möglich eine Entscheidung darüber zu fällen was wir als nächstes tun wollen, oder welches Ziel wir als nächstes anstreben möchten. Diese Entscheidungen sind nur möglich, weil wir das eine Ergebnis für wertvoller halten als das andere. Dadurch dass wir ihnen einen Wert zuschreiben, nehmen wir unausgesprochen an, dass es eine übergeordnete Bedeutung gibt, welche einer Möglichkeit mehr Gewicht verleiht als einer anderen. Sich 4 Siegpunkte zu holen, statt nur 2, ergibt nur Sinn, weil es besser ist mehr Siegpunkte bei Spielende zu haben als weniger. Und es ist nur deshalb besser, weil es mir wichtig ist das Spiel zu gewinnen. Wäre mir gewinnen egal, dann wäre es mir auch egal wie viele Siegpunkte ich bekomme; und wenn mir das egal ist, kann ich keine vernünftige Entscheidung fällen.
Spannung existiert als logische Folge meines emotionalen Investments in ein konkretes Ergebnis. Wir wollen dass Martys DeLorean bei 140 km/h vom Blitz getroffen wird, weil wir emotional in seinen Erfolg investiert haben. Wir wollen dass Rey Kylo Ren abweist, weil wir nicht wollen, dass sie der dunklen Seite der Macht verfällt. Wir wollen, dass Ferris nicht von Mr. Rooney geschnappt wird, weil wir nicht wollen das der fantastische Eskapismus zerstört wird, bevor der Film zu Ende ist. Diese Momente sind spannend, nicht nur weil sie so gut gefilmt sind, sondern weil wir auf eines der Ergebnisse unsere Emotionen gesetzt haben. So lange diese Filme laufen, ist uns ihr Ausgang wichtig. Wir haben sie mit Bedeutung versehen, in dem wir unsere Gefühle daran geknüpft haben.

Aber jeder der sich noch an seine erste Liebe erinnert, wird wissen: nur weil wir ein Mal tiefe Gefühle empfunden haben, heißt das nicht, dass wir es immer noch tun. Aber dadurch werden diese Erfahrungen dennoch nicht belanglos. Ihre Folgen mögen sich verlaufen haben, aber während wir sie erlebten, waren sie von Bedeutung. Das Gleiche gilt auch für Bücher oder Filme. So lange wir emotional drin stecken, sind sie uns wichtig und sind von Bedeutung. In einigen seltenen Fällen nehmen wir diese Erfahrungen mit uns und werden von ihnen eine nicht unbedeutsame Zeit lang beeinflußt. Auch das unterstreicht nur, dass wir all diese Dinge bedeutsam nennen, die uns im jeweiligen Moment, emotional beeinflußen. So wie wir durch das Eintreten in den Magischen Kreis eines Spiels es akzeptieren, dass das Spiel während des Spielens (d.h. so lange wir uns im Magischen Kreis aufhalten) für uns von Bedeutung ist. Wenn wir uns dabei ertappen wie wir das Spiel intensiv erleben und unsere Emotionen an einen bestimmten Ausgang knüpfen, müssen wir auch akzeptieren dass Brettspiele Bedeutung haben. Sie mögen zwar außerhalb des Spielens keine Folgen haben, aber es ist ihre Bedeutsamkeit, die es uns ermöglicht sie überhaupt zu spielen.
Warum also fällt es uns so schwer vom Gedanken los zu lassen, dass Spiele nicht nur von geringer Konsequenz, sondern auch von vernachlässigbarem Wert sind? Es kann sein, dass es dafür ganz praktische Gründe gibt, wie Jesper Juul in Art of Failure sehr anschaulich erklärt. Um uns darauf gefasst zu machen, dass wir womöglich ein Spiel verlieren könnten, an einer Aufgabe scheitern und so unangenehme Erfahrungen ausgesetzt sind, nutzen wir vorsorglich den Begriff der Bedeutungslosigkeit, um die Wirkung, die Spiele auf uns haben, wortwörtlich klein zu reden. Bevor wir uns der Gefahr aussetzen, dass unsere emotionale Einbindung zu intensiv wird, streiten wir Spielen ihre Bedeutung und damit auch ihre Effektivität ab, unser Gefühlsleben zu beeinflußen. Es ist ein geistiger Taschenspielertrick, den wir seit Kindesbeinen einstudiert haben. Es wird uns beigebracht sich nicht über ein Spiel aufzuregen, da ein Spiel bedeutungslos ist. Man sagt uns wir sollen würdevoll verlieren (d.h. so, dass andere davon nicht belästigt werden) und dass wir unsere emotionale Reaktion auf die Ereignisse in einem Spiel dämpfen sollen, mit der vermeintlich vernünftigen Erklärung, dass es „nur ein Spiel ist und nicht so wichtig“. Man bringt uns bei und wir geben diese Lehre weiter, dass Spiele belanglos sind und unsere emotionale Antwort darauf (von einigen erlaubten Ausnahmen abgesehen) unpassend und unangemessen sind. Daher sollte es nicht überraschen, wenn unsere Spielerfahrung sehr oberflächlich bleibt und es uns schwer fällt Spiele als legitimes, narratives Medium anzuerkennen.
Man stelle sich folgendes Experiment vor und wer möchte, kann es gerne selbst mal ausprobieren: Wir machen es uns gemütlich und wollen uns einen guten Film anschauen. Kein hin geklatschter Schund, voller lauter Geräusche und nackter Haut, sondern „großes Kino“. Ein Film, der echte Gefühle herbeibeschwören will, in dem das Mitgefühl der Zuschauer für die Figuren geweckt wird und sie mit den Ereignissen der Geschichte mitfiebern. Jedes Mal, also, wenn man sich dabei ertappt mit einer Figur mitzufühlen, sich Sorgen um ihr Schicksal macht, oder sich über den Egoismus des Gegenspielers empört, kann man sich einfach daran erinnern: „es ist nur ein Film!“. Während diese Szene gefilmt wurde, stand die Filmcrew gelangweilt hinter der Kamera beim 15. Take dieser Szene; oder einer der Schauspieler hält während er seinen Text spricht einen Furz zurück, usw. usf. Kurz gesagt, man rufe sich einfach durchgehend ins Gedächtnis, dass die Bedeutung dieses Films vollkommen künstlich ist. Man tut das einfach immer wieder, wenn man bemerkt, dass der Film versucht einen emotional zu packen. Die Chancen stehen gut, dass man sich vom Film nur sehr oberflächlich angesprochen gefühlt hat. Es war bestenfalls eine nette, unterhaltsame Ablenkung für den Kopf. Vielleicht hat man versucht den wahren Täter in einem Krimi zu erraten, oder die unausgesprochenen Beweggründe des Gegenspieler, etc. Eine solche Erfahrung würde es einfach machen zu argumentieren, dass Filme zwar eine nette geistige Herausforderung darstellen, aber einen wohl kaum auf eine emotionale Reise mitnehmen. Die Künstlichkeit des Films wäre ja so offensichtlich, es wäre zu einfach sich einfach davon zu distanzieren.

„Es ist nur ein Film. Da geht‘s um nichts, außer zu Spaß haben.“
Nichts anderes machen wir mit Spielen. Wir weigern uns die Erfahrungen das Spiels als vorübergehend bedeutungsvoll oder relevant zu erkennen, weil wir indoktriniert wurden, sie nur als belanglos zu begreifen. Bisher gibt es nur eine vorherrschende Erfahrung für die Brettspiele konzipiert werden: der Wettstreit. Man stelle sich vor Filme und Bücher hätten ein Genre, eine emotionale Erfahrung, die so präsent ist, dass ein Großteil der Spiele sie versuchen umzusetzen oder sie irgendwie zumindest teilweise einzubinden. Wie verzerrt, wie einseitig und wie wenig massentauglich würden diese narrativen Medien uns dann vorkommen?
Aber jenseits unserer Vorurteile was Spiele leisten können, und dadurch was wir ihnen zugestehen zu tun, stellt sich auch die Frage, was wir mit ihnen eigentlich anstellen. In wie weit erlauben wir Emotionen Teil des Spiels zu sein? Das ist der zweite Grund, weshalb wir bei Brettspielen nicht weinen.
2. Erlaubnis
Ich denke ich werde niemals müde werden zu sagen, dass Spielen eine soziale Erfahrung ist. Nicht nur wegen der offensichtlichen Tatsache, dass wir die meisten Spiele nur in Gegenwart anderer Leute spielen können. Aber die soziale Erfahrung reduziert sich nicht nur darauf, dass wir gemeinsam Zeit verbringen, wenn wir spielen.
Spiele sind im Kern interaktiv. Bei Videospielen findet diese Interaktion mit der Maschine und dem Programm statt. Diese legen die Grenzen der Interaktion fest. Sie schaffen die Regeln nach denen wir spielen und sorgen dafür, dass sie eingehalten werden. Bei Brettspielen übernehmen Spieler diese Aufgabe. Wir etablieren die Normen des Spiels in dem wir ausdrückliche Regeln (Spieldesign) und indirekte Regeln (Spielgewohnheiten) wählen. Wir sind es, die die Grenzen des Magischen Kreises setzen und einhalten. Alles was innerhalb des Magischen Kreises geschieht, ist gemeinsames Spielen. Alles was außerhalb geschieht, ist gemeinsamer Zeitvertreib. In Brettspielen drückt sich die soziale Erfahrung und das Gemeinschaftliche durch das Spielen aus. Es sind nicht – wie oft fälschlich gedacht – die Gespräche, das Essen und Trinken oder die persönliche Interaktion, die außerhalb des Spiels stattfinden. Diese können natürlich auch soziale Erfahrungen sein. Arten auf die wir Gemeinschaftlichkeit formen und erleben können. Aber sie finden zusätzlich zum Spielen statt, nicht wegen des Spiels oder durch das Spiel. Auch wenn es Leute gibt, die Spiele als Vorwand nutzen um mit anderen Zeit zu verbringen, liegt das Soziale am Spiel in der Spielhandlung selbst. Wenn wir Spiele also soziale Erfahrung sehen wollen, müssen wir akzeptieren, dass sie nicht Auslöser für ein soziales und gemeinschaftliches Miteinander sind. Spiele sind das gewählte Mittel mit denen wir uns spielend mit anderen Menschen austauschen wollen. (Das ist auch der Grund, weshalb es so wichtig ist, dass Spieldesigns mehr erforschen müssen als Siegpunktesammlungs-Wettbewerbe, die nur einen Gewinner kennen.)

Innerhalb des Spielens haben sich kulturelle Normen etabliert. Meistens durch sozialen Druck, der manche Verhaltensarten begrüßt aber andere ablehnt. Bei Brettspielen sind aufrichtig empfundene Gefühle während des Spiels an jedem Spieltisch tabu. Frustration wird meist nur akzeptiert wenn man sie ironisch überzeichnet ausdrückt. Tatsächlicher Frust wird als Zeichen fehlender Reife gesehen. Ein Sieg darf nur in gemäßigter und zurückhaltender Art gefeiert werden, um nicht als schlechter Gewinner abgestempelt zu werden. Wer es wagt beim Verlieren eines Spiels sich so zu ärgern, dass er einen Moment braucht um sich wieder zu fangen… wie man es etwa bei einem besonders rührendem, tragischen Film tun würde… der wird schnell verdächtigt emotionale Probleme zu haben. Denn „traurig sein“, geht bei Brettspielen so gar nicht! Unsere persönlichen Spielgemeinschaften, d.h. die Leute mit denen wir spielen, kontrollieren genau welche Gefühle man ausdrücken darf und grob in welcher Form. Lautes, herzhaftes Gelächter ist in der Regel in Ordnung. Aber Schadenfreude ist nur unter bestimmten Umständen erlaubt. In Gruppen in denen ich teilnehme, scheint es mir, dass Spieler die sehr arrogant oder überheblich auftreten, bei Niederlagen durchaus verspottet werden dürfen. Allerdings würde ich es für völlig indiskutabel halten sich über einen Spieler lustig zu machen, der kämpfen muss aus dem letzten Platz herauszukommen. Aufrichtiger Ärger darf sich meiner Erfahrung nach nur durch „offensichtlich“ ironische Wort- oder Tonwahl äußern, oder muss stoisch geschluckt werden. Wer sich nicht an die Spielgebräuche einer Gruppe hält, gefährdet das zerbrechliche Gleichgewicht zwischen Freundschaftlichkeit und Wettstreit.
Diese Beispiele sind nicht dafür da um zu sagen, dass die persönliche Meinungsäußerung in keinster Form beeinträchtigt werden darf. Für so einen fundamentalistischen Unsinn ist mir meine Zeit zu schade. Es ist auch kein Plädoyer, dass man Spielern erlauben sollte zu wüten, zu schreien und zu heulen wenn sie Spiel spielen. Was ich damit verdeutlichen will, ist dass diese Einschränkungen der emotionalen Bandbreite und Tiefe in Brettspielen nicht dem Medium selbst innewohnen. Sie sind eine Folge der Spielkultur, die wir am Tisch verbreiten und ein Resultat der Sozialisierung an der wir uns als Mitglieder dieses Hobbies beteiligen. Der Grund weshalb uns Brettspiele nicht zu Tränen rühren, liegt nicht darin dass Spiele diese Emotionen nicht wecken können. Es liegt daran, dass wir wir es verbieten solche Emotionen beim Spielen auszudrücken.
Ich denke für viele Menschen ist die geringe, emotionale Einbindung im Spiel, die sie mit ihrer Spielgruppe erleben, Teil dessen was das Hobby so attraktiv für sie macht. Wie ein verlässlicher Episodenfluss einer familienfreundlichen Sitcom, oder die beruhigende Vertrautheit eines Genres wie der romantischen Komödie. Brettspiele sind eine Möglichkeit Spiel wie einen Entspannungstee zu erleben. Aber Spiele können mehr als das leisten. Es kommt allein darauf an, ob wir gewillt sind das auch umzusetzen.

- [Buchbesprechung] „What Board Games Mean to Me“ - 21. April 2024
- Wie verwerflich ist es im Spiel zu ‚töten‘? - 7. April 2024
- „Ja, hat Spaß gemacht.“ - 17. März 2024
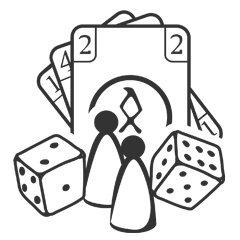





Dass Spiele keine Trauer hervorrufen, liegt meiner Meinung nach in erster Linie daran, dass sie so gut wie keinen Anlass dafür bieten. Dazu müssten wir doch erstmal eine emotionale Nähe zu einem Spielelement aufbauen, um über dessen Sterben trauern zu können. Das mag bei langjährigen Rollenspielen der Fall sein, wenn ein liebgewonnener Charakter nach zwei Jahren stirbt und die Regeln keine Wiederbelebung vorsehen. Aber bei Village bspw. baut man keine Beziehung zu seinen Spielfiguren auf, die man auf dem Dorffriedhof beerdigt. Sie sind Mittel zum Zweck; man ist Herrscher über seinen kleinen Kosmos, wie ein General über seine Soldaten. Man nutzt sie, aber liebt sie nicht, nimmt sie nicht als Individuen wahr. Also warum sollte man trauern? Der Anlass fehlt, nicht die Erlaubnis.
Bei einem kurzem Spiel … da gibt es allenfalls das kleine Geschwisterkind der Trauer: das Bedauern. Konkret kenne ich das von den Kosmos-Exit-Spielen, bei dem man Spielmaterial zerstören muss. Wir können es nicht übers Herz bringen, es zu zerstören und behelfen uns, indem wir abzeichnen oder sonstwie Ersatz verwenden. Und dabei geht es nicht darum, 12 Euro für das Spiel zu sparen, sondern es ist einfach schade, ein Spiel zu zerstören. Um dieses Bedauern zu vermeiden, verweigern wir uns der Aufforderung.
Zorn und Freude gehen auch eine Weile über das Spiel hinaus, sind aber letztlich temporär, brauchen keine materielle Basis. Trauer ist aber realem Verlust vorbehalten, den wir im Spiel vermeiden. Wir sind ja nicht blöd.
Dass es beim Film klappt, liegt daran, dass die Handlung darauf abzielt, dass wir eine emotionale Beziehung zum Werk aufbauen, während das Spiel in erster Linie das Medium ist, das emotionale Beziehungen zwischen Mitspielern herstellt, um die wir nicht trauern wollen. Ich halte es nicht für völlig unmöglich, Trauer im Spiel zu erzeugen, aber es ist diesem Medium sehr weitgehend wesensfremd. Denn man muss emotionale Beziehungen zu im Spiel vorkommenden Charakteren aufbauen. Dazu fehlt es oft an Entwicklungszeit in einer Partie und an einer Ausdifferenzierung der Charaktere.
Übrigens: „Es ist nur ein Film“ klappt bei mir oftmals nicht; selbst dann nicht, wenn ich mich bereits vom Film distanziert habe, mich über übertriebene unrealistische Gefühlsduselei ärgere … das Auge tränt mitunter doch … und verstärkt so den Ärger. Nicht in jedem Hirn schafft es der Verstand das Gefühl auszutricksen. Vielleicht macht sich da meine „weibliche“ Seite bemerkbar… :) .
Apropo weibliche Seite: „Wäre mir gewinnen egal, dann wäre es mir auch egal wie viele Siegpunkte ich bekomme; und wenn mir das egal ist, kann ich keine vernünftige Entscheidung fällen.“
Es gibt durchaus Spiele, bei denen mir die Siegpunkte völlig egal sind und ich trotzdem Spaß habe, weil anderes im Vordergrund steht. Solche Spiele sind aber selten, generell sprechen Spiele eben meine „männliche“ Seite stärker an, wenngleich selten eine Seite völlig schläft.
Wie zu Beginn erwähnt, habe ich nur zwei Gründe in diesem Artikel näher ausgeführt. Die Diskrepanz zwischen unserem Fokus während des Spiels und wo wir glauben unsere Aufmerksamkeit zu verorten, wäre ein weiterer. Natürlich identifiziert sich niemand bei einem Spiel wie Village mit den Spielfiguren, die man leben und sterben lässt. Genauso wie sich niemand mit Indiana Jones‘ Hut oder Peitsche identifiziert, Luke Skywalkers Lichtschwert oder John McClanes T-Shirt. Es sind die Protagonisten mit denen wir leiden und triumphieren. Bei Spielen sind wir das selbst. Da unterscheidet sich ein Brettspiel in der Tat nur sehr oberflächlich von einem Rollenspiel. Aber Brettspiele haben – anders als Filme oder Bücher – eher die umgekehrte Hürde, dass wir keine Distanz zu unserem Protagonisten aufbauen können, ohne dabei die Bedeutung des Spiels auszuhöhlen.
Es ist schwer einen emotionalen Sicherheitsabstand zu uns selbst zu halten und gleichzeitig voll und ganz auf die Herausforderungen des Spiels einzusteigen. Wohl gemerkt: es ist schwer, aber es ist nicht unmöglich. In bestimmten Rollenspielen wird diese Fähigkeit durchaus vorausgesetzt bzw. trainiert. Ich denke hier an Indie-Rollenspiele wie Monster Hearts, My Life with Master oder auch Polaris. Können wir dort ein Gleichgewicht von emotionaler Distanz und Investment halten, so eröffnen sich große, dramatische Erlebnisse in diesen Spielen, die Herzschmerz, Trauer und auch Tragik abdecken können. Durch den kleinen kognitiven Trick eine „Rolle“ zu spielen, überlisten wir unsere Tendenz negative emotionale Erfahrungen meiden zu wollen. Wir leiden mit „uns“ mit, ohne dabei selbst zu leiden.
Tendentiell sind daher auch die sogenannten „amerikanischen“ Spiele mit ihrem Augenmerk jedem Spieler eine fassbare Rolle zuzuweisen, eher für emotionalere Spielerfahrungen geeignet, als abstraktere Spiele, bei denen man eine diffuse übernatürliche Macht ist, die die Geschehnisse auf dem Spielbrett lenkt.
Ein tolles Thema und sehr lesenswert dargestellt, vielen Dank!
Ich habe es durchaus erlebt, dass Spiele zu emotionalen Situationen geführt haben. Es liegt aber ganz klar an der Art des Spiels. Nüchternen Euros und Optimierspielen geht es darum, ihre Spieler auf der planerisch-geistigen Route zu stimulieren. Sobald es aber in Richtung Interaktion und Verhandlungen geht, investieren die Personen am Tisch durchaus in den Spielverlauf – und wollen dafür Erfolg und zeigen sich aktiv enttäuscht, wenn etwas in die Hose geht.
Ich stelle hier nun die These auf, dass es von einer empathischen Komponente im Spiel abhängt, ob die Spieler emotionale Bandbreite und Tiefe erleben. Das Medium hat sie (zugegebenermaßen niedrig), aber gänzliches Fehlen würde ich nicht attestieren. Auch Filme können, wenn das Empathielevel niedrig ist, ihre Rezipienten kalt lassen (auch wenn dies nicht intendiert sein mag). Die emphatische Komponente im Spiel ist immer dann groß, wenn ich mich in die möglichen Spielzüge anderer besonders intensiv hineindenken muss oder wir Deals verabreden. Als Beispiele fallen mir Junta oder Twilight Imperium ein: Verhandlungen, Allianzen und Übereinkünfte werden diskutiert und auch gebrochen. Wer kennt nicht Geschichten von Freundschaften, die nach einer Runde Junta zerbrachen? Den berühmten „table flip“, wenn der Alliierte plötzlich das vertrauensvoll leicht verteidigte Heimatsystem annektiert?
Spiele haben eine starke kognitive Anforderung – aber ich möchte behaupten, dass auch (kognitive) Empathie eine Rolle spielt; schließlich müssen Spieler die Perspektiven, Gedanken und Pläne ihrer Mitspieler erkennen und einschätzen, um zu gewinnen. Spielen ist eine soziale Tätigkeit, wie Du anfangs schreibst, und Empathie ist ein sozialer Baustein dafür. Und wer hier viel investiert, der reagiert bestimmt sehr emotional.
Guido, Emotionen gibt es reichlich, klar; man ist ja selbst betroffen. Aber für Trauer fehlt i.A. der Anlass.
Wobei Tränung auch durch Rührung fließen können. Ist bei Filmen zumindest bei mir auch deutlich häufiger als, weil ich um jemanden trauer.
Aber auch das ist natürlich eine bei Brettspielen seltene Emotion…
Es gibt Gegenbeispiele. Spieler berichten dann von emotional sehr herausfordernden Entscheidungen und Situationen – jenseits des Meta-Spiels („ich bin der Protagonist“) und ja, auch Tränen. Einige Beispiele:
Bei „Les Poilus“ sind wir Soldaten im Schützengraben des I. Weltkrieges. Es geht ums gemeinsame Überleben.
Video-Review mit einer Einführung in genau dieses Thema:
https://www.boardgamegeek.com/video/88700/grizzled/game-about-being-human-and-decent
Bei „Pandemic Legacy I“ (SPOILERALARM!) sterben Charaktere oder stellen sich als Verräter heraus – nach einem Dutzend gemeinsamer Anstrengungen, die Welt zu retten.
Bei „Freedom- The Underground Railroad“ retten wir geflohene Sklaven, indem wir sie vor Sklavenjägern in Sicherheit bringen – nach Kanada.
Was haben diese Spiele gemeinsam?
– Figuren haben Namen
– Figuren sind individualisiert (visuell / Charaktereigenschaften / Historie)
– Die Spiele sind kooperativ
– Es sind Rahmengeschichten mit „Bedeutung“ – es geht für die Figuren wirklich um etwas
– Es gibt Konsequenzen innerhalb des Spiels, die über Siegpunkte hinausgehen, oft negative Konsequenzen
Was geschieht da? Es geht um Empathie (wie oben schon erwähnt) – Empathie läuft über die Aktivierung von Spiegelneuronen: bei Filmen bilden Sehen, Hören, Situation, Persönlichkeiten, Stimmen, der Realismus, etc. die 150%-Einladung des „Spiegelns“: Wir erleben quasi hautnah mit, was da passiert. Vielleicht interessant: Point of View-Einstellungen verstärken die Empathie NICHT. Eher im Gegenteil. Wenn uns jemand direkt in die Kamera „schlägt“, ist der Kontrast zum realen im Kino Sitzen so groß, dass wir eher auf Distanz gehen. Sehen wir aber, wie jemand geschlagen wird, ist es wie im echten Leben. Er wird „tatsächlich“ geschlagen. Und am emotionalsten wirkt auch hier nicht die „nahe“ Handkamera-Aufnahme, sondern die ungeschnittene, lang anhaltende, beobachtende Einstellung. Z.B. hier ab 2:00: https://www.youtube.com/watch?v=nNKvRZFKACI
Stellen wir uns ein Mensch Ärgere Dich Nicht vor, in dem die Figuren zunächst von den Spielern mit Namen versehen werden (jedes Figurenset hat einen gemeinsamen Familiennamen) und dann individuell gekennzeichnet ihren Weg antreten. Zudem ist das Startfeld ein Zustand tiefster Not (nehmen wir doch mal ein KZ – siehe auch das Spiel „Train“ von Brenda Romero https://www.wired.com/2013/12/brenda-romero/), aus dem jede Figur ausbricht und die vier Zielfelder sind lebensrettend (Plätze auf einem Dampfer nach New York).
Naja, viel Spaß beim „Rauswerfen“.
Klar, das ist jetzt per Vorschlaghammer, aber das Prinzip bleibt ähnlich wirksam, wenn wir Hunde- und Katzenfamilien nehmen, die aus dem Tierheim ausbrechen und am Ende wartet eine freundliche Familie mit Haus im Grünen.
Warum Autoren und Verlage nicht stärker auf die narrative Power setzen, ist klar und oben schon benannt: Weil Spiele eben als „nebenbei-Beschäftigung“, als „kurzer Nervenkitzel“ betrachtet werden – wie Fahrgeschäfte auf dem Rummel oder das Fest der Volksmusik. Oder eben als „Puzzle“, als „Brainburner“, als logischer Wettkampf à la Schach und all den letztlich abstrakten Excel-Tabellen mit distanzierenden Themen wie Mittelalter-Gilden oder Weltraum-Kolonisierung für sogenannte „Vielspieler“.
Das sind aber Gründe unserer Kultur / Gesellschaft. Weniger wesentliche „Mängel“ des Mediums Spiel an sich. Das ist, als würde man aufgrund von Kriminalkurzgeschichten und den Fabeln von Äsop der schriftlichen Erzählung an sich absprechen, uns mitfühlen zu lassen. Oder aufgrund von Action-Blockbustern und Schweighöfer-Komödien behaupten, Film sei reine Popcorn-Jahrmarkts-Unterhaltung und tiefere Emotionen ausgeschlossen.
Man könnte durchaus mal ein bisschen mutiger sein. Es muss ja nicht gleich das KZ sein.
Das war ja mal ein sehr schöner Artikel – vielen Dank dafür. Auch die Diskussionsbeiträge gehen erfreulich tief.