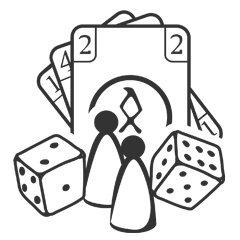Input und Output sind zwei Begriffe aus der Informatik, die auch im Spielejargon ihre Berechtigung haben. Das Schöne an diesen Begriffen ist, dass sie ziemlich intuitiv sind, da die meisten Spielenden eine ziemlich gute Vorstellung davon haben dürften, was damit gemeint sein könnte (Konjuktiv for the win).
Der Input, den ein Spiel verlangt, ist der Teil, den ich als handelnde Person in das Spiel stecken muss, um etwas zu erreichen. Im Prinzip also ein anderes Wort für den Aufwand, den ich treiben muss, um etwas spielveränderndes anstellen zu können. Nur ist „Aufwand“ eben sehr viel diffuser und sehr viel undeutlicher – darunter ist ja u.a. auch oft gemeint, wie viel Aufwand es ist, das Spiel überhaupt spielen zu können, im Sinne von „der Aufwand das Spiel auf den Tisch zu bringen ist zu hoch für das Spielerlebnis“ oder „Der Spielaufbau ist schon sehr aufwendig“. „Aufwand kann sich also auf alles mögliche Beziehen: Geistige und physische Arbeit, Aufwand für das ganze Spiel, für das Starten eines Spieles oder für die einzelnen Züge. Da ist es schon besser einen abgegrenzteren Begriff zu nutzen: Input bezieht sich ganz konkret auf meine Spielhandlung: Was mache ich, wenn ich an der Reihe bin?
Der Output ist das was man mit dem Input erreicht, also gewissermaßen die Reaktion des Spieles auf meine Handlung. Genauer gesagt, ist der Output der Teil der Spielsituation, der sich durch meinen Zug ändert: Ich spiele eine Karte und gebe entsprechende Rohstoffe ab (Input) und bekomme dafür ein neues Gebäude (Output). Wenn das Gebäude keinerlei Auswirkungen auf den kommenden Spielverlauf hat, ist der Output praktisch Null. Wenn dieses Gebäude alle anderen Variablen im Spiel ändert, ist der Output hoch. Der Output ist also ein Maß für den Einfluss, den man auf die Spielsituation geübt hat.
Würden diese beiden Begriffe nur benutzt um zu beschreiben was man warum tut, wären sie relativ überflüssig, denn das kann man auch ohne sie tun. Interessant ist die Beziehung der beiden: Der Input muss im angemessenen Verhältniss zum Output stehen. Anders ausgedrückt: Für die Energie die ich reinstecke möchte ich angemessen kompensiert werden. Muss ich einen großen Aufwand treiben, um kleine Effekte zu erzielen, so wirkt das schnell demotivierend, weil man nicht das Gefühl hat, viel Einfluss zu nehmen. Vor allem fühlt sich das Spiel dann oft unnötig kompliziert oder hakelig an; das Spieltempo stimmt nicht. Das muss nicht unbedingt an der Zuglänge liegen: Bei Scythe etwa sind die Züge kurz. Dafür muss ein großer Aufwand betrieben werden, um verhältnismäßig kleine Effekte – etwa das Überqueren eines Flusses – zu erzielen. Oft gehen dem verhältnismäßig kleinen Output „Einen Schritt über den Fluss machen“ stehen oft rundenlange Vorbereitungen entgegen. Daher wird Scythe als etwas sperrig oder zumindest als langsam empfunden (unabhängig davon, wie es sonst gefällt).
Wie sieht es mit dem umgekehrten Fall aus? Generell gesprochen haben klassische Spiele einen sehr hohen Wirkungsgrad (damit bezeichne ich das Verhältnis aus Output und Input): Wenig Input bei viel Output. Man denke an Schach, bei der jede Bewegung einer Figur die Lage auf dem Brett enorm ändern kann oder Skat, bei der eine einzelne Karte zur richtigen Zeit, die Runde entscheidet. Kommt dieser hohe Wirkungsgrad aber in Verbindung mit einer geringeren Übersicht (und/oder wenig Feedback vom Spiel), kann das Spiel schnell als „unvorhersehbar“ oder „swingy“ wahrgenommen werden. Wenn jede Karte das Spielgeschehen massiv ändert, ich aber gar nicht wissen kann, was alles möglich ist oder ich keine Möglichkeit habe, mich auf die neue Situation einzustellen oder diese zumindest partiell vorherzusagen, kann das frustrieren. Ich würde aber argumentieren, dass dies kein Input/Output-Problem ist, sondern eben ein Problem der Übersicht oder gar der Ausrichtung des Spieles.
Generell halte ich einen hohen Wirkungsgrad für ein erstrebenswertes Designziel in Spielen. Schlechte Wirkungsgrade sollen oft als Herausforderungen für die Spielenden dienen, die sie zwingen (oder es ermöglichen, je nach Sichtweise), „Mikromanagement“ zu betreiben, sich also auf die Details zu kontrollieren – etwa die Reihenfolge in der Rohstoffe genommen werden oder den optimalen Weg über die Leisten auszumachen. Ich halte diese Details aber für weniger interessant als Herausforderungen, die durch die Mitspielenden gestellt werden. Auch Puzzles sollten die eigentliche Puzzelei in den Vordergrund stellen und nicht die Herausforderung die Puzzleteile in die Hand zu nehmen. Spiele mit hohem Wirkungsgrad fühlen sich aus diesen Gründen direkter und/oder eleganter an. Anders ausgedrückt: Sie sind denen mit niedrigem Wirkungsgrad überlegen. Hohe Wirkungsgrade können auf zwei Arten erreicht werden: Durch Senkung des Inputs oder Steigerung des Outputs. Liegen die beiden allerdings weit auseinander, wird -wie bei einer Knizia-Wertung – vor allem der negativere Part wahrgenommen (der hohe Aufwand für die Züge oder der geringe Output), insofern werden beide Teil bei gutem Design nicht allzu stark voneinander abweichen. Die Abweichung ist jedoch nicht das Problem, sondern das Symptom. Das gilt es bei einer kritischen Analyse eines Spieles – sei es beim rezensieren, sei es beim Spieldesign – zu berücksichtigen.
ciao
peer
- Der Fall des Hauses Asmodee? - 28. April 2024
- Jenseits des Tellerrandes: Delicious in Dungeon - 14. April 2024
- Zielführende Überlegungen - 24. März 2024