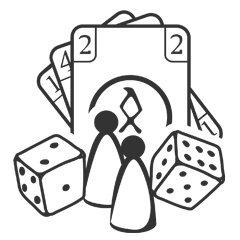Partyspiele haben in der Spieleszene ihren ganz eigenen Platz. Sie stehen etwas abseits von den anspruchsvollen Strategiespielen mit denen sich die erfahreneren Spieler*innen gern beschäftigen. Sie sind in mancher Hinsicht im Geiste noch mit dem Kinderspiel verwandt, richten sich aber deutlich an ein älteres Publikum. Vor allem aber, finden sie gerade bei Seltenspieler*innen Anklang, die sich eher vorstellen können ein Partyspiel auszuprobieren, statt sich einem fordernden, stundenlangen Wettstreit der Taktiken und Strategien auszuliefern.
Partyspiele und solchen, die im Spielgefühl an sie erinnern sind besonders, da sie uns erlauben über unser eigenes Unvermögen zu lachen. Ein Spiel wie etwa Galaxy Trucker ist anfänglich von einem hohen Maß an Hektik geformt. Unter Zeitdruck müssen wir eine fordernde Aufgabe erfüllen. Im Anschluss sehen wir dabei zu, wie unsere erbrachte Leistung mit einem hohen Maß an Zufall zerstört wird. Unter Vielspieler*innen löst das wahlweise Gelächter und Spielfreude oder Frustration und Ablehnung aus.
In solchen Spielen kommt es immer wieder vor, dass wir mit dem eigenen Unvermögen konfrontiert werden. Sei es weil wir schlecht zeichnen können, aber mit wenigen Strichen unter Zeitdruck einen Begriff oder eine Idee kommunizieren sollen. Oder weil wir während die Sekunden ticken oft nicht die richtigen Worte finden, und unbeholfen vor uns her stammeln was denn dieses Ding, na dieses Ding.. na du weißt schon… Miriam hat doch so viele davon… warum kommst du denn nicht drauf? Wie deutlich kann ich denn noch werden?
Es sind Spiele, die zu Gelächter führen. Aber es ist eben gerade nicht das hämische und abschätzige Lachen, mit dem wir uns über die Menschen stellen, die etwas nicht können was doch „so einfach“ ist. Es ist ein Lachen des Mitleidens, des Sich-Selbst-in-Anderen-Wiedererkennen und damit der Verbundenheit. Wir erkennen uns selbst im Scheitern des anderen wieder und finden darin etwas, das uns eint. Die Dinge an denen unsere Mitspieler*innen scheitern sind die selben, die auch uns zu schaffen machen werden, wenn wir am Zug sind. Wir verstehen unser gegenseitiges Scheitern nicht als Schaffung einer Hierarchie des spielerischen Könnens, sondern als Gleichmacher zwischen den unvollkommenen, aber gerade darum so sympathischen Personen mit denen wir an einem Tisch sitzen dürfen.
Dieses Umarmen des Scheiterns ist nicht nur zutiefst menschlich, es ist auch für viele ein Befreiungsschlag vom Leistungsdruck, der in vielen Spielrunden ganz selbstverständlich entstanden ist. Aber woran liegt das eigentlich? Ist die Brettspielszene derart von überpriviligierten Personen bevölkert, dass wir uns nur zum Spaß und der eigenen Belustigung einem Leistungs- und Erfolgsdruck aussetzen? Oder reproduzieren wir in unseren Spielen und mit unseren Freunden einfach nur die kulturellen Dynamiken, die wir in anderen Bereichen unseres Lebens sehen? Wenn wir ansonsten immer zeigen müssen, dass wir belesener, klüger, charismatischer sind als andere… warum dann nicht auch im Spiel?

Die bequeme und auch sehr billige Antwort – frei nach der „survivorship bias“ – lautet natürlich, dass Menschen, die gerne spielen es tun, weil sie eben diesen Leistungsdruck genießen. Spielen heißt leisten, herausragend sein und sich im Wettkampf mit ebenbürtigen Gegner beweisen.
Das halte ich mit Verlaub für Kokolores. Also vor allem das dem Spiel dieser Wert innewohnt und dass es sich durch diese Eigenschaften erst als Spiel auszeichnet. Dafür sind die oben erwähnten und in der Masse viel Zuspruch findenden Partyspiele einfach zu gegenläufig konzipiert. Denn gerade weil Partyspiele diesem Leistungsprinzip so selten gerecht werden, sind sie für ein Gros der Spieler*innen erst attraktiv.
Denn es ist in meinen Augen eine tragische Fehleinschätzung, dass die Regelmenge an sich neue Spieler*innen einschüchtert. Es ist viel öfter die Befürchtung, dass ein Spiel mit vielen Regeln auch viel Leistung abverlangen wird. Nicht nur, dass man diese Regeln erlernen und verinnerlichen muss. Es gilt sie auch noch hoch-kompetent einzusetzen und durchgehend zu bedenken. Der Erwartungsdruck an die Spielgruppe, den diese Spiele oft vorausschicken, schüchtert ein und schreckt ab. Das gilt für den Aufwand, der damit einher geht mitzuhalten. Aber auch für die Gruppendynamik mit der man rechnen muss, wenn das allgegenwärtige Scheitern eben nicht mehr verbindet, sondern die Erfolgreichen von den Versagern trennt.
Viele nehmen diese Hierarchisierung in Kauf, weil es bedeutet Teil der Gruppe zu sein und Zeit mit Menschen zu verbringen, die man mag. Aber daraus folgt nicht, dass diese Duldung des Leistungsprinzips auch mit einer Vorliebe dafür einher geht. Menschen lernen ihr Leben lang sich an unbequeme Situationen anzupassen, wenn das bedeutet, dass sie dafür andere Vorzüge genießen können.
Es ist die Annahme des Leistungsprinzips als Normalzustand des Spiels welches hier ein Problem darstellt. Sowohl auf Seiten der Vielspieler*innen, die in ihrer Begeisterung für die vielen Vorzüge des gemeinsamen Spielens diese kleine Barriere oft nicht mehr wahrnehmen; als auch auf Seiten der Designer*innen, Entwickler*innen und Verlage, die das Scheitern nur noch als emotionale Höchststrafe verstehen, aber eben nicht als Motor für gemeinsamen Spielspaß. Scheitern als die drohende Schmach und Ungnade, die einem droht, wenn man nicht gut genug ist.
In beiden Fällen ist das Brettspiel dadurch ärmer geworden. Anstatt im Spiel zu lernen mit Rückschlägen und dem Scheitern spielerisch und konstruktiv umzugehen, findet viel mehr eine Abhärtung statt. Wenn wir uns nur oft genug die Knie blutig geschrammt haben, dann stört uns es nicht mehr, wenn wir uns mal voll auf die Nase legen. Wir lernen zu verlieren, in dem wir uns dagegen abstumpfen oder einfach „besser werden“. Wer gelernt hat gut zu spielen, muss nicht mehr mit Niederlagen umgehen müssen. Wer beides nicht erreicht hat, verfängt sich womöglich schnell in der oft lamentierten Entscheidungsunfähigkeit (analysis paralysis).
In letzter Konsequenz ist das die Lehre, die wir aus dem Leistungsprinzip in Spielen ziehen müssen. Das Scheitern ist eine Blamage, der wir uns nur dadurch entsagen können in dem wir den Spielsieg für belanglos erklären oder einfach dadurch überzeugen, dass wir zu gut sind, um noch zu verlieren. Dieses Leistungsprinzip birgt dann auch den Boden, um „loss aversion“ in den Mittelpunkt der meisten Spielentscheidungen zu setzen. Das wiederum führt zur Erkenntnis, dass die einzig rationale Antwort lautet, lieber gar nicht zu spielen statt zu verlieren.
Eine Erkenntnis, die bereits viele Nichtspieler*innen zur Welt gebracht hat. Denn so lange die enge und festgefahrene Sicht auf Spiele als Bühnen der Leistungsdarbietung vorherrscht, bleibt das Scheitern eine Strafe, die es um jeden Preis zu vermeiden gilt. Sie bleibt ein Schreckgespenst, welches uns umhertreibt und uns zwingt bestimmte Entscheidungen zu fällen. Sie bleibt, zumindest für die meisten Menschen, ein Grund das Spielen mit anderen zu meiden.
Aber wie viel mehr Verbundenheit und Humor erlauben uns Spiele zu erleben, wenn wir Scheitern als Teil des Spiels und auch als mögliche Quelle für das verstehen, weshalb wir uns oft und immer wieder an den Tisch setzen: um Spaß zu haben.
Der Schlüssel dazu liegt, wie in so vielen Dingen, nur zu einem kleinen Teil in den Spielen selbst. Die Freude am Scheitern ist nicht aus den Regeln, dem Thema oder dem Spielmaterial abzuleiten. Sie entsteht aus der Art des Miteinanders am Spieltisch. Sie ist eine Folge dessen wie wir, gerade als Vielspieler*innen, zeigen was für uns am Spielen wirklich von Bedeutung ist.
- [Buchbesprechung] „What Board Games Mean to Me“ - 21. April 2024
- Wie verwerflich ist es im Spiel zu ‚töten‘? - 7. April 2024
- „Ja, hat Spaß gemacht.“ - 17. März 2024