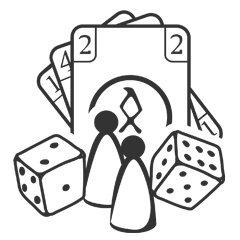Auf der diesjährigen Games Developers Conference gab es unter anderem eine Podiumsdiskussion zu Brettspielen. Es ging darin um die Lage und die Zukunft von Brettspielen. Schon nach etwa 15 Minuten fiel eine besonders erkenntnisreiche und treffende Bemerkung: jedes Spiel welches zwei oder mehr Spieler*innen zusammenbringt, wird automatisch zu einer sozialen Aktivität. Es wird zu einem Gesellschaftsspiel.
Diese Bemerkung will ich als Absprungpunkt nutzen, um die soziale Rolle von Spielenden etwas näher zu betrachten. Damit sind nicht die auf der Spielschachtel umschriebenen Rollen gemeint, in die wir vermeintlich schlüpfen, wenn wir das Spiel spielen. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass dieser Schritt praktisch nie gemacht wird. Es ist nur ein rhetorischer Kniff mit dem Spielverlage und auch Kritiker in wenigen Worten Bilder entstehen lassen, die zwar gefällig sind aber nur selten informieren. Wir sind keine gefangenen Tiere in Kuzooka oder antike Stadtplaner in Akropolis. Wir bleiben Spieler*innen an einem Tisch.
Aber eben jene Rolle, die wir am Tisch tatsächlich einnehmen, ist es wert näher betrachtet zu werden. Denn darin finden sich mehrere Aufgabenbereiche oder Funktionen wieder, denen wir nachkommen müssen, damit das Spiel funktionieren kann und wir uns daran erfreuen können.
Ganz grob skizziert lassen sich hier drei eigenständige Bereiche erkennen: der Administrative, der Operative und der Performative. Oder anders formuliert: wie verwalten, wir handeln und wir spielen.

Der administrative Bereich hat, wie schon gesagt, vor allem mit Verwaltung zu tun. Hier geht es um Regeln, so wie wir sie meistens mit Spielen in Verbindung bringen. Wir halten sie ein, wir wenden sie an und wir sorgen dafür, dass sie während des Spiels aufrecht erhalten werden. Der Spielaufbau ist der Punkt an dem dieser Bereich am Stärksten bemerkbar ist. Wir mischen Kartenstapel mischen und verteilen einzelne Karten an unsere Mitspieler*innen. Wir versetzen Spielsteine auf dem gemeinsamen Spielbrett, um bestimmte Vorgänge oder Effekte zu markieren. Wir geben der Rundenmarker weiter. Aber es betrifft auch auf welche Aktionsfelder wir auf dem Spielbrett mit unserer Figur ziehen dürfen. Unsere administrativen Tätigkeiten haben das Ziel die Rahmenbedingungen für das gemeinsame Spiel zu schaffen. Im administrativen Teil des Spielens setzen wir Anweisungen ohne eigene Einflußnahme um.
Was alles unter den administrativen Teil fällt, wird fast vollständig in der Spielanleitung dokumentiert. Vereinzelt mag man sich an diesem Teil erfreuen, weil es Spaß macht viele Würfel zu Würfeln, Lücken durch das Legen eines Plättchens zu schließen oder eben Markierungen auf seinem Punktezettel zu setzen. Dennoch gilt es als gutes Design, wenn der administrative Teil des Spiels möglichst gering gehalten wird. Gerade weil es eben nur gedankenloses Ausführen von exakten Vorgaben ist. In unserer administrativen Rolle sind wir quasi Automaten: wir sind bewegbare Spielsteine der Menschen, die das Spiel gemacht haben.
Ironischerweise werden Anleitungen oft danach beurteilt, wie penibel und exakt sie diese automatisierenden Anweisungen kommunizieren. Dabei ist genau dieser Ansatz der vielleicht wichtigste Grund, weshalb Seltenspieler*innen die Finger von modernen Brettspielen lassen.
Der zweite Aufgabenbereich, der die Spieler*innen-Rolle auszeichnet, ist der operative Bereich. Mit einfachen Worten fällt darunter alles was Entscheidungen betrifft. Von welchem Kartenstapel will man nachziehen? Auf welches Feld will man seine Würfel setzen? Welchen der Mitspieler*innen will man in diesem Zug angreifen? Während der administrative Bereich keine Entscheidungen, sondern nur Ausführungen abdeckt; betrifft der operative Bereich allein Entscheidungen und keine Automatismen. Es ist der Teil des Spielerlebnisses, in dem wir uns interaktiv mit dem Spiel beschäftigen. Der operative Teil deckt damit auch die Punkte, des Spielerlebnis ab, in denen wir Möglichkeiten abwägen, unsere Chancen kalkulieren oder auch nur unser Bauchgefühl zu Rate ziehen, welche Option man als nächstes wählen sollte.
Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass manche Spiele stark dafür kritisiert werden, wenn der operative Teil des Spielerlebnisses zu gering ausfällt. Es wird bemängelt, dass man vom Spiel „gespielt wird“. Man hat das Gefühl zu wenig Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen zu können (Stichwort: „player agency“). Die unausgesprochene Erwartungshaltung an das Spiel lautet, dass eine größere operative Rolle, also mehr Entscheidungen, zu einem Spiel führen, welches mehr Spaß und Zufriedenheit erzielt. Dem ist aber nicht zwingend so. Ein Spiel kann auch mit verhältnismäßig geringem operativen Raum für Spaß und ein gelungenes Beisammensein sorgen. Als Beispiel seien hier vor allem Glücksspiele, Partyspiele oder auch einige Ärgerspiele genannt.
Der Grund dafür und auch der eigentliche Grund, weshalb rein administrative und operative Aufgaben aus einem Spiel noch keine soziale Aktivität machen, findet sich in der dritten Rolle (bzw. dem dritten Aufgabenbereich) wieder: dem Performativen.
Gesellschaftsspiele sind immer eine Form von Theater. Im Rahmen des Spiels wird uns eine soziale Rolle zugewiesen. Diese versuchen wir dabei so gut wie möglich zu erfüllen. Dabei ist „gut“ hier als relative Qualität zu verstehen, welche von den anderen Spieler*innen am Tisch eingeschätzt wird. Es gibt keine objektiven Kriterien nach denen man ermitteln kann, wie erfolgreich man seiner (performativen) Rolle am Tisch nachgekommen ist.

Wie zu Beginn erwähnt, geht es bei diesen Rollen nicht um die thematische Einkleidung der Spielregeln. Wir sind keine Gewürzhändler im Orient, europäische Entdecker im 17. Jahrhundert oder politische Anführer eines interplanetarischen Imperiums. Für den performativen Aufgabenbereich geht es darum, welche Rolle uns die Spielmechanismen zu Grunde legen: Konkurrenten, Kontrahenten, Partner, etc. Um unseren Verpflichtungen an das Performative nachzukommen, spielt es eine Rolle in welchem Verhältnis wir innerhalb des Spiels zu einander stehen.
Nehmen wir diese Rollen nämlich nicht ein bzw. füllen diese unzureichend aus, so leidet unser Spielerlebnis darunter. Das Spiel macht schlicht keinen Spaß. Das soll nicht heißen, dass man sich in einem konfrontativen Spiel gefälligst hart anzugehen hat. Es kann aber eine Art sein, wie man der performativen Rolle nachkommt. Entscheidend ist, dass wir diese Rolle derart ausfüllen, wie es innerhalb der Gruppe akzeptiert wird.
Wenn das Spiel mir die Rolle eines Kontrahenten zuweist, also jemand der auf Kosten anderer den Spielsieg erlangen muss, so muss ich diese Rolle ausführen und „performen“. Das bedeutet, ich muss mich sowohl darauf einlassen als auch zeigen, dass ich mich mit meinen Mitspieler*innen im direkten Konflikt befinde. Es reicht nicht „zu wissen“, dass man ein konfliktreiches Spiel spielt. Diese Konflikte müssen sich auch innerhalb unseres magischen Zirkels wiederfinden lassen. Sie müssen durch offenes aussprechen oder besser noch durch unser Verhalten anerkannt und erkannt werden.
Die auffälligste Form ist durch „trashttalk“ gegeben; also das Einschüchtern der Gegenspieler oder das auffällige Prahlen wegen der eigenen Überlegenheit. In einer gesunden Spielrunde ist dieser Teil auch offensichtlich Theater, das heißt nicht mit ernstgemeinter Überzeugung vorgetragen. In anderen Spielen, kann das performative Element der Spieler*innen-Rolle etwa durch das Wehklagen, Beschweren und Schimpfen über das eigene Pech oder eine schlechte Kartenhand erfolgen. In einem Ärgerspiel drückt sich die performative Rolle eben auch dadurch aus, dass man sich sichtlich „ärgert“, wenn der eigene Plan vereitelt wurde. Das Performative in einem kooperativen Spiel kann sich etwa etwa dadurch zu erkennen geben, dass man den Dialog mit anderen sucht, gute Ideen lobt oder Vorschläge anderer aufnimmt. Gerade auch Spiele mit komplexen Aufgabenstellungen in denen Einfallsreichtum und Planungsgeschick gefordert sind, benötigen Spieler*innen, die ihre performative Rolle erfüllen und Erfolge mit Erstaunen oder anderen Formen der Wertschätzung ausdrücken.
Es ist die performative Ebene des Spiels, die uns erlaubt in das Spielerlebnis einzutauchen. Sie bestätigt und bekräftigt den magischen Zirkel des gemeinsamen Spiels. Es braucht uns als Spielende, die ihre Rollen wie in einem Theaterstück ausfüllen, damit aus einer streng reglementierten Aufgabe, die wir durch unser zielgerichtetes Handeln zu Ende führen, ein Spielerlebnis wird an dem wir uns erfreuen können.
Ein Spiel, welches mit zwei oder mehr Personen gespielt wird, ist vorrangig eine soziale Aktivität. Damit diese für uns alle zufriedenstellend und unterhaltsam ist, müssen wir auch gerade als Mitspieler*innen gewissen Anforderungen gerecht werden. Etwa unserer Fähigkeit eine Rolle zu spielen.
- [Buchbesprechung] „What Board Games Mean to Me“ - 21. April 2024
- Wie verwerflich ist es im Spiel zu ‚töten‘? - 7. April 2024
- „Ja, hat Spaß gemacht.“ - 17. März 2024