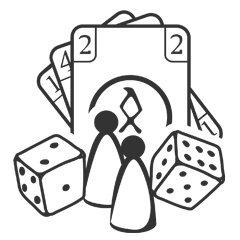Vor einigen Tagen stolperte ich online über eine Studie zu digitalen Spielen in der untersucht wurde, ob und wie sich Spiele auf das Wohlbefinden auswirken. Unterschiede zeichneten sich erst aus, wenn man extrinsisch und intrinsisch motiviertes Spielverhalten getrennt betrachtete.
Diese zwei Kategorien an Antrieben halte ich für eine durchaus interessante Linse, um sich Brettspiele genauer anzuschauen. Ich vermute dass es verschiedene Phänomene innerhalb unserer Spielerlebnisse gibt, die sich dadurch besser greifen und vielleicht sogar erklären lassen.
In Rahmen dieses Artikels werde ich die Begriffe „extrinsische“ und „intrinsische Motivation“ wie folgt anwenden. (Anmerkung: Ich habe nicht Psychologie studiert, noch will ich den Eindruck erwecken, dass ich eine Authorität in diesem Thema wäre. Ich eigne mir diese Begriffe hier nach kurzer Recherche an, um über Spiele zu sprechen. Nicht über Motivationspsychologie. Dafür gibt es sicherlich qualifiziertere Stimmen.)
Mit „extrinsischer Motivation“ soll Spielverhalten beschrieben werden, welches sich aus äußeren Zielen und Belohnungen ergibt. Eine „intrinsische Motivation“ hingegen findet aus sich selbst heraus seine Begründung. Das etwas abgedroschen wirkende Sprichwort: „Der Weg ist das Ziel.“ greift einen vergleichbaren Gedanken auf. Das Gegenstück dazu, für die extrinsische Motivation, lautet: „Unser Tun ist ein Mittel zum Zweck.“
Wer schon etwas länger spielt und sich darüber mehr als flüchtige Gedanken gemacht hat, wird hier Parallelen im Brettspiel sehen. Die (externen) Regeln setzen ein Ziel für das Spiel fest und so lange unsere Verhalten allein diesem Ziel untergeordnet sind, spielen wir mit extrinsischer Motivation.
Wenn man jedoch betrachtet wie viele Spiele sich in ihren Zielsetzungen ähneln, wird klar, dass allein extrinsische Motivation nur unzureichend beschreiben kann, warum manche Spiele immer und immer wieder Spaß machen. Die extrinsische Motivation welche uns anfangs antreibt, nutzt sich mit der Zeit ab. Erst wenn die spielerische Interaktion an sich reizvoll und erfüllend ist, entwickeln wir eine intrinsische Motivation zu spielen. Wir erfreuen uns am Spielen, und nicht allein am Spiel. Im Idealfall ist unsere extrinsische wie auch intrinsische Motivation eng miteinander verwoben. Bernie DeKoven umschreibt in „The Well-Played Game“ ein ähnliches Phänomen, wenn das gemeinsame Tennis-Spiel auf einem Niveau stattfindet, in dem Spielfreude und Wettkampf zu einer Einheit verschmelzen.
Es kann jedoch auch passieren, dass extrinsische und intrinsische Motivation nicht zusammenfinden. So beschreibt Twitter-Nutzer Matt Coates (@efalafel) seine Erfahrung mit einem Online-Turnier des Spiels Downforce: „a common winning strategy is decidedly not fun“. Eine weit verbreitete Siegstrategie macht ausdrücklich keinen Spaß. Diese Erfahrung ist nicht selten. Daher ist es in Designer-Kreisen eine der gängigen „best practices“ heutzutage, dass die zielführende Strategie auch immer die sein sollte, die den Spielakt am stärksten aufwertet.
Ein extrinsisch motiviertes Spielen ist auch an die Erwartung gekoppelt, dass das Erreichen des vorher identifizierten Ziels durch eine Belohnung gewürdigt wird. Bleibt diese Belohnung aus, so ist man frustriert. Typische Beispiele dafür sind die Auswirkung von Zufallselementen (z.B. Würfel, Karten ziehen, etc.) die die Folgen der eigenen Entscheidung stark beeinflussen. Aber auch „Kingmaker“-Situationen in denen der Sieg an einer Entscheidung einzelner Mitspieler*innen hängt, frustrieren deswegen. Wenn man das Brettspiel nah mit dem sportlichen Wettstreitethos verknüpft sieht, dann ist das Ausbleiben der persönlichen Wertschätzung, Anerkennung und Gratulation bei Spielsieg ein weiterer Punkt der Enttäuschung. (Wobei hier das Spieldesign eine sehr untergeordnete Rolle spielt.)
Diese Belohnungsstruktur, aus der wir unsere extrinsische Motivation herleiten, muss man sich bei einem neuen Spiel jedoch immer erst erarbeiten und erschließen. Die Lernkurve, die in vielen Spielkritiken eine zentrale Rolle einnimmt, besteht im Kern darin diese externe Strukturen zu verstehen, um das Spiel mit der zutreffenden extrinsischen Motivation spielen zu können.
Wir lernen wie das Spiel gedacht ist, damit wir uns nach den Zielen und Belohnungen des Designs ausrichten können. Haben wir uns dabei geirrt und verfolgen die falschen Ziele, so ist das frustrierend. So als würde man sich mühsam herausgesucht haben zu welcher Postfiliale man sein Paket tragen muss, nur um vor Ort zu entdecken, dass die Filiale geschlossen ist. Der extrinsisch motivierte Spaziergang findet keinen Abschluss und das wohlige Gefühl etwas erfolgreich zu Ende gebracht zu haben, tritt nicht ein.
Es ist sicherlich auch einer der Gründe, weshalb Kritiker*innen ermahnen ein Spiel mehrfach zu spielen, bevor man sein Urteil fällt. Manchmal brauch es mehr als eine Partie, um sich diese Belohnungsstruktur zu erschließen. Vor allem, da das individuelle Spielerlebnis stark negativ geprägt wird, wenn man mit einer falschen Ausrichtung gespielt hat. Eine Spielrezension kann hier sehr viel bewirken, da sie – wenn sie den Rahmen der reinen Regelwiedergabe verlässt – diese extrinsische Motivation besser veranschaulichen kann als es das Regelwerk oft tut.
Aber Spielerlebnisse, die allein extrinsisch motiviert sind, nutzen sich mit der Zeit ab. Irgendwann ist der Punkt erreicht an dem die immer gleiche Belohnung für die immer gleich wirkende Handlung nicht mehr ausreicht, um sich an den Spieltisch zu setzen. Manche Autoren und Verlage versuchen diesem Problem beizukommen, in dem sie die Variabilität einzelner Elemente des Spiels drastisch erhöhen, z.B. in dem man Kartenstapel mit weit über 200 individuellen Karten beilegt.
Zusätzlich ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht sehr bequem, ein Spiel durch den Verkauf zusätzlicher Produkte (in Form von Erweiterungen) längerfristiger Umsatz generieren zu lassen. Aus Kundenperspektive erhält man hier mit verhältnismäßig wenig zusätzlichem Aufwand ein Spiel, welches immer neu und immer leicht anders extrinsisch motiviert. Es gibt neue Strategien zu entdecken, neue Kombinationen auszuprobieren, neue Fraktionen zu spielen, etc.
Aber für die Langlebigkeit eines Spiels ist die intrinsische Motivation wichtiger. Man muss die Eigenschaften des Spielakts betrachten und sich fragen was Spieler*innen daran genießen. Es sind nicht sorgfältig austarierte Spielmechanismen oder ihre vielfältige Kombinationsmöglichkeiten, die hier den Ausschlag geben. Es ist auch nicht die Ergebnisoffenheit des Wettstreits. Das Spielerlebnis und seine prägenden Merkmale entscheiden, ob ein Spiel reizvoll ist und langfristig Leidenschaft weckt.
In meinen Augen ist es die Aufgabe der Kritik genau dieses Spielerlebnis nach diesen Punkten zu durchleuchten. Eine Spielkritik kann hier das Erlebnis in Worte fassen und dem Publikum veranschaulichen. Der Aufruf über Emotionen in der Spielkritik zu sprechen, aber auch auf die unergründliche Magie des Spiels zu verweisen, findet meiner Meinung nach hier ihren Ursprung.
Die Auseinandersetzung mit einem Spiel, die Kritik, ist die Frage nach dem Warum des Spiels.
Im Gegensatz zu den Belohnungsstrukturen des Spiels lässt sich das jedoch nicht durch sorgfältiges Dokumentieren der Spielregeln abdecken. Auch ist die Nacherzählung der eigenen Spielerfahrung dafür nur bedingt zu gebrauchen. Von der thematischen Umschreibung des Spielverlaufs ganz zu schweigen.
Wenn wir uns tiefer mit Spielen beschäftigen wollen und insbesondere mit jenen Spielen, die uns lange zu begeistern wissen, müssen wir unseren Blick auf unsere eigenen Beweggründe richten.
Beitragsbild: F&S105 will nicht, Fotograf: Andreas Gartner
- Wie verwerflich ist es im Spiel zu ‚töten‘? - 7. April 2024
- „Ja, hat Spaß gemacht.“ - 17. März 2024
- Verschwimmt die Grenze zwischen digital und analog? - 3. März 2024