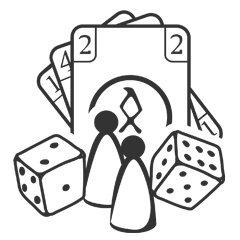In der Spielkritik ist es üblich das Designhandwerk eines Spiels danach zu beurteilen wie viel Einfluss Spielende auf den Spielverlauf nehmen können. Das ist nicht verwunderlich. Schließlich ist es die Interaktivität, die das unverzichtbare Merkmal eines Spiels darstellt. Je interaktiver ein Medium ist, umso eher wird ihm der Charakter eines Spiels zugesprochen.
Wir verstehen das Spiel damit nicht nur als Bereich in dem unsere Handlungen Wirkung zeigen, sondern verbinden dieses Handeln auch damit ein konkretes Ziel zu verfolgen. Die Siegbedingung des Spiels macht dieses Ziel fassbar und so versuchen wir, von Ehrgeiz getrieben, dieses Ziel zu erreichen. Damit schleicht sich unbemerkt eine Idee in das Spielumfeld ein, welche mehr Aufmerksamkeit verdient hat: das Spiel als meritokratischer Wettstreit. Ohne es laut aussprechen zu müssen, spielen wir in der Überzeugung, dass der „bessere Spieler“ gewinnen wird. Der Spielakt geht im Spiel auf und dient als Vergleichsmaßstab zwischen den Spielenden.

Dieser Vergleich und damit auch der Sieg ist dadurch gerechtfertigt, dass Spielende direkt auf den Verlauf und Ausgang des Spiels Einfluss nehmen konnten. Der Sieg zum Spielschluss baut auf der eigenen Leistung auf und das ist auch der Grund weshalb man der siegreichen Person Respekt zollen muss. Im Mikrokosmos des eben gespielten Spiels gelten die einfachen Regeln, nach denen die Welt funktionieren sollte. Wer besser spielt, hat den Sieg verdient und damit auch die Achtung der Konkurrenten.
Der Aufwand, den ein Spiel zeitlich, mental und auch emotional einfordert, wird erst dadurch gerechtfertigt, dass man an Hand dieser erbrachten Mühe gemessen wird. Abseits des Spieltisches mag das Leben unüberschaubar kompliziert und ungerecht sein. Wenn man den Spieltisch verlässt, findet man sich von Sexismus, Rassismus, Klassismus und sämtlichen hässlichen Farben des Patriarchats umgeben, die willkürlich einzelne Personen unten halten.
Das macht das Spiel zu einem Zufluchtsort vor der gefühlten Ungerechtigkeit der großen, weiten Welt der „Erwachsenen“. Im Spiel gelten noch die nostalgisch verklärten Regeln aus unserer Kindheit. Wenn man sich nur richtig anstrengt, kann man alles erreichen. Der spielerische Wettstreit ist in letzter Instanz auch immer der Rückzug in das Gefühl des selbstbestimmten Schicksals.
Vielleicht ist gerade das einer der wichtigsten Gründe weshalb Spiele so attraktiv bleiben. Mehr noch als die Aussicht auf Gemeinschaft und soziales Miteinander, existiert das Spiels als Kleinod in dem man zu Ruhe kommt und sich gegen zumindest diese eine Herausforderung behaupten kann. Im Spiel sind wir nicht mehr machtlos.
Das macht manche Niederlagen darum auch so bitter, wenn wir ohne großes Mitgefühl aus dieser Fantasiewelt gerissen werden und in der unnachgiebigen Realität landen. Der Ort, der uns immer wieder mit der einfachen Wahrheit konfrontiert, dass wir alleine machtlos sind und bleiben.
Unter kulturellen Gesichtspunkten betrachtet, scheint das Spiel und das Spielverständnis der Spielenden festgefahren. Die Spielbeschäftigung wiederholt lediglich das immer gleiche Dogma: „Leistung lohnt sich. Dein Handeln entscheidet über deinen Erfolg. Wenn du nicht Erfolg hast, dann hast du einfach falsch gehandelt. Denn es liegt ja alles immer in deiner Hand.“ Der Thesaurus bezeichnet das als Ideologie.
Hat man ausreichend Erfahrung mit Spielen gesammelt, festigt sich darum die Erwartungshaltung, dass sich die eigene Leistung im Spiel zu lohnen hat. Endet ein Spiel in einem unverdienten Sieg, so gilt das Spiel als suspekt. Häufen sich unverdiente Siege und Niederlagen gilt das Spiel als vollends misslungen.
Wenn einem Spiel vorgeworfen wird, dass es „broken“ ist, dann rührt diese Kritik nicht aus einem ästhetischen Bedürfnis nach mathematischer Parität der Gewinnchancen. Der Unmut entsteht weil man das Gefühl hat, das Spiel hätte sein implizites Versprechen an die Spielgruppe gebrochen: Siege müssen schließlich durch Leistung verdient werden und nur darum sind errungene Siege auch verdient.
– Danny Rojas
Im Film hat das Happy End keinen besonders guten Ruf. Es wird schnell als Kitsch abgetan. Man weist es weit von sich, weil es ein falsches, unauthentisches Bild zeichnet. Ein Bild von einer Welt in der wahre Liebe sich immer findet und bis ans Lebensende glücklich ist. Ein Bild in dem die Gerechten erfolgreich sind, die Schwachen beschützt werden und jedes Verbrechen am Ende vergolten wird. Es ist ein Bild in dem nicht nur die Guten am Ende siegen, sondern auch selbst für diesen Sieg verantwortlich waren. Sie haben ihn sich ehrlich, redlich und mühsam erkämpft. Sie haben sich den Sieg verdient.
Die für mich interessantesten und wertvollsten Designmomente in einem Spiel sind immer mehr jene, in denen sich das Spiel dieser unausgesprochenen Erwartungshaltung der Kontrolle verweigert. Das kann zum Beispiel die radikale Kürzung der Entscheidungsfreiheit sein. Ein Spiel wie Love Letter wird dafür kritisiert, dass man mit nur zwei Karten auf der Hand nur selten eine Entscheidung treffen muss. Entweder die Regeln erlauben es nicht, oder die Entscheidung ist derart klar in „gut“ und „schlecht“ aufteilbar, dass man kaum darüber nachdenken muss. Wie verdient kann hier ein Sieg wirklich sein?
Seit Jahren drohe ich meinem Bekanntenkreis damit eine lange Abhandlung darüber zu schreiben, warum ich DungeonQuest für eines der großartigsten und vielleicht für die Spielkultur wichtigsten Spiele überhaupt halte. Auch hier spielt der gewollte und bewusste Bruch mit Erwartungen eine wichtige Rolle.
Die Präsentation von DungeonQuest baut auf das typische Fantasyrollenspiel im Stile von Dungeons & Dragons auf. Eine Spielform, die sich vor allem durch ihre fast grenzenlose Freiheit auszeichnet mit der imaginierte Orte und Situationen erforscht werden können. Das Spiel bedient sich sämtlicher visueller und thematischer Verweise, um eben diese Assoziationen zu wecken. Die Regeln hingegen brechen mit grundlegenden Konzepten, die wir mit Rollenspielen im Allgemeinen, und Dungeoncrawlern im Speziellen verbinden.
Statt der Freiheit alles Vorstellbare zu versuchen, gibt es durch Spielplättchen klar vorgegebene Begrenzungen. Statt taktisch kluger Entscheidungen, gibt es das Urteil der Spielgruppe wie mutig man gehandelt hat. Statt einer geordneten Spielwelt, die man bezwingen kann, herrscht der reine Zufall. Die Regeln des Spiels werfen uns in einen chaotischen Wirbelsturm eines mitleidlosen Universums. Es ist ein Spielerlebnis, welches einen immer wieder nur mit der eigenen Machtlosigkeit konfrontiert sieht. Die Coen Brüder haben aus diesem Lebensgefühl ja eine ganze Filmlaufbahn gemeißelt.
Natürlich ist das alles zu einem gewissen Grad eine ästhetische Vorliebe. Manche Menschen hören lieber schwermütige Musik statt fröhlicher. Manche Menschen schauen lieber tieftraurige Dramen an Stelle lebensfroher Komödien. Manche spielen gerne Spiele mit einem großen Zufallselement, andere ziehen einen ausreichend kontrollierbaren Spielverlauf vor.
Es geht hier nicht darum persönliche Vorlieben auf- oder abzuwerten. Sämtliche oben genannten Genres haben in ihren jeweiligen Medien ihre Berechtigung, ganz unabhängig davon welche davon dem eigenen Geschmack näher kommen mögen. Nicht jedes Musikstück, nicht jeder Film und auch nicht jedes Spiel, liefert die emotionale Erfahrung, die man sucht und zu schätzen weiß.
Genau das gilt für das Maß an Kontrolle, welches man in einem beliebigen Spiel ausüben kann. Es ist Teil der emotionalen Erfahrung des Spiels. Das Abschneiden zum Ende des Spiels kann mit der erbrachten Leistung einhergehen oder eben durch äußere Umstände bestimmt werden. Es ist gut möglich keine Fehler zu machen und dennoch zu verlieren. Das ist kein Zeichen von Schwäche, das ist das Leben. (Picard)
Gute Filmtragödien definieren sich – und das wird manchmal vergessen – nicht dadurch, dass sie kein glückliches Ende nehmen. Vielmehr ist es das Erleben der Katharsis, die am Ende eintritt, die uns als Zuschauer mit einem guten, gereinigten Gefühl in die Welt hinauslässt. Diese emotionale Note zu treffen, ist den meisten Brettspielen verwehrt. In letzter Zeit war es vielleicht nur The King’s Dilemma, welches bereit war eine solche Erfahrung überhaupt einzuräumen. Denn diese Annäherung an Katharsis setzt auch voraus, dass man als Spielgruppe in der Lage ist diesen Ausgang des Spielerlebnis als solche zu erkennen, einzuordnen und zuzulassen.
Ich merke, dass ich es immer öfter zu schätzen weiß, wenn ich die Spielrunde auch mal mit dem Gefühl verlassen kann, nicht in der heilen Fantasiewelt der meritokratischen Leistungsvergleiche verbracht zu haben. Das Spielerlebnis fühlt sich für mich authentischer an, und näher an meinem Lebensgefühl, wenn ich weiß, dass ich mein Schicksal eben nicht allein in der Hand hatte. Es fühlt sich ehrlicher an, wenn am Ende ein unüberschaubares und undurchdringliches Geflecht an Faktoren den Ausgang des Spiels entschieden hat. Gerade wenn es Faktoren waren, über die ich nicht verfügen kann; egal wie sehr ich mich auch bemühe.
Die Regeln eines Spiels setzen unserem Wunsch den Spielausgang zu kontrollieren Grenzen. Vielleicht sollten wir uns in der Kritik seltener fragen, ob diese Grenzen zu eng oder zu weit gezogen wurden; sondern wie es sich anfühlt und was es eigentlich bedeutet wenn man nur so viel Kontrolle ausüben kann, wie einem das Spieldesign zugesteht.
Fútbol is also death.
And (…) Fútbol is Fútbol, too.“
– Danny Rojas
Photo by Yoann Boyer on Unsplash
Photo by Jeffrey F Lin on Unsplash
- Wie verwerflich ist es im Spiel zu ‚töten‘? - 7. April 2024
- „Ja, hat Spaß gemacht.“ - 17. März 2024
- Verschwimmt die Grenze zwischen digital und analog? - 3. März 2024