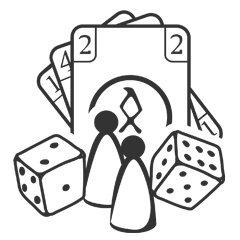Nachdem ich im letzten Artikel kurz umrissen habe, dass ein grundlegendes Unterscheiden der verschiedenen Spielspaßquellen notwendig ist, um Spielkritiken zu verfassen.. will ich diesmal einen weiteren in meinen Augen wichtigen Punkt umreißen.
Als Kritiker*in sollte man verstehen wie ein Spiel eigentlich funktioniert.
Gemeint ist damit nicht die Regeln des Spiels gelesen und verinnerlicht zu haben. Man muss ein Spiel sicherlich erklären können, um es überhaupt sinnvoll zu benutzen. Allerdings ist das in meinen Augen noch nicht ausreichend, um eine Kritik dazu verfassen zu können. Die Fähigkeit meine Kaffeemaschine richtig zu bedienen, befähigt mich noch nicht zu beurteilen, ob sie gut gemacht ist. Entsprechend benötige ich ein robustes Verständnis dafür wie Spiele als solches funktionieren. Das heißt aus welchen Bestandteilen sie sich zusammensetzen und wie diese in einander greifen, um bestimmte Spielerlebnisse zu ermöglichen.
Für eine Filmkritik muss ich begreifen können wie ein Film eine Geschichte erzählt. Für ein Spiel muss ich entsprechend begreifen, wie die unterschiedlichen Aspekte des Spiels zusammenkommen, um so meine Spielerfahrung zu formen. Dazu gehören grundlegende Konzepte wie Zielsetzungen, Anreize, Bedienbarkeit und Zugänglichkeit des Spiels, usw. Aber es geht auch um weitere Facetten des Spiels wie etwa das Material, die grafische Aufmachung, die Begriffe mit denen sich das Spiel präsentiert und jene, die am Spieltisch tatsächlich genutzt werden. In manchen Fällen spielt auch ein größerer Kontext eine Rolle, wie etwa Verlag und Schaffende selbst, die Themenwahl zu bestimmten Zeitpunkten, ihre redaktionelle Aufarbeitung, etc.
Zusätzlich muss man fragen wie viel Raum der Gruppe gelassen wird über, unter oder exakt auf einem bestimmten Niveau zu spielen. Manche Spiele setzen bestimmte Verhaltensweisen zwingend voraus. So sind viele Eroberungsspiele darauf ausgelegt, dass die Spielenden den direkten und offenen Konflikt suchen; und sich kontinuierlich und konsequent gegenseiting daran hindern voranzukommen. Manche Spiele gehen davon aus, dass die Spielgruppe die Regeln bis ins letzte Details ausreizen und beugen werden, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Etwa weil die Annahme da ist, dass das Spielverhalten allein vom Ehrgeiz getrieben ist den Sieg zu holen.
Es geht darum zu begreifen wie Design – auch in einem Spiel – funktioniert, um zu identifizieren wann die eigene Spielrunde womöglich nicht dem Spieltypus entspricht, der in den Regeln vorausgedacht wurde. Manche Elemente eines Spiels existieren nur, weil ein bestimmtes Verhalten von der Gruppe erwartet wird. Andere fehlen aus dem gleichen Grund.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Medienverständnisses lautet, Interaktivität als zentrales Element des Spielerlebnisses zu begreifen. Damit ist nicht die Möglichkeit gemeint sich gegenseitig Karten, Ressourcen oder Spielsteine wegzunehmen. Vielmehr geht es darum, dass die Regeln zwar als Rahmen für unser Verhalten angenommen werden, dieses Verhalten innerhalb des Spiels jedoch auch von den persönlichen Vorlieben geleitet wird. Das tatsächliche Spielerlebnis ist darum eben nicht allein aus der Anwendung und Auslegung der Spielregeln ableitbar, sondern auch von der Entscheidungsfreiheit der Spielenden geprägt, die selbst die Tonalität des Spielerlebnis festlegen können.
Wenn wir uns das Spielerlebnis als Bild vorstellen wollen, dann mag das Spiel (mit seinen Inhalten, Regeln, etc.) die Umrisse des Motivs vorgeben, aber es ist die Spielgruppe selbst die wählt welche Farben sie nutzen und wie genau sie diese Umrisse ausfüllen wollen. Interaktivität ist im Spiel nicht allein mechanisch zu verstehen, sondern umfasst auch unsere Vorstellungskraft, emotionales Investment und den zwischenmenschlichen Umgang, den wir innerhalb des Spiels aus- und erleben. Ein Spiel wirkt nicht allein auf die Spielgruppe, um ein Spielerlebnis zu vermitteln; die Spielenden wirken ihrerseits auf das Spielerlebnis und richten so das Erlebte und Empfundene zum Teil selbst aus.
Man muss sich als Kritiker*in bewusst sein, dass diese Wechselwirkung zwischen dem Gegenstand Spiel und den durch die Gruppe geschaffenen „Spielraum“ das Spielerlebnis formt. In einer kritischen Auseinandersetzung mit einem Spiel reicht es nicht zu erkennen, dass eine andere Spielgruppe ein anderes Spielerlebnis mit dem gleichen Spiel haben kann. Man muss auch erkennen können wie diese unterschiedlichen Erfahrungen entstehen. Denn gerade daraus lässt sich erkennen an welchen Stellen das Spieldesign besonders deutlich wirkt oder fehlt.
Die unter Kritiker*innen verbreitete Praxis ein Spiel mit unterschiedlichen Spielgruppen zu spielen, fruchtet auch deshalb, weil sie derartige Dynamiken deutlich macht. Man kann sich sicherlich darüber streiten, ob es zwingend nötig ist ein Spiel mit vielen grundverschiedenen Spielgruppen zu spielen, um diese Dinge auszuarbeiten oder ob der gleiche Erkenntnisgewinn mit ausreichend Medienkompetenz bis zu einem gewissen Punkt kompensierbar ist. Der Meinung mag es da viele geben, aber letzten Endes lässt sich festhalten, dass man begreifen muss wie ein Spiel auf die Gruppe wirkt (und umgekehrt), um es kritisch beurteilen zu können.
Es reicht nicht zu wissen, dass eine andere Gruppe mit dem gleichen Spiel eine andere Spielerfahrung haben kann. Teil des kritischen Handwerks ist auch zu erklären zu können, warum das so ist. Oder zumindest zu wissen, woher man sich diese Antworten holen kann. Darüber geht es im nächsten Teil dieser Reihe.
- Wie verwerflich ist es im Spiel zu ‚töten‘? - 7. April 2024
- „Ja, hat Spaß gemacht.“ - 17. März 2024
- Verschwimmt die Grenze zwischen digital und analog? - 3. März 2024