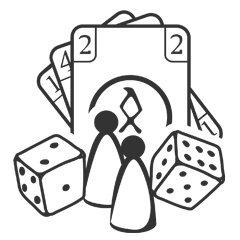Anscheinend ein Standardwerk in Sachen Spieldesign ist das Buch „A theory of fun for Game design“ von Ralph Koster. Es ist von einem Computerspielentwickler geschrieben und Computerspiele stehen im Fokus, aber das Buch hat den Anspruch universeller zu sein und eine allgemeine „Spaßtheorie“ zu bieten, explizit als Hilfe für Autoren. Das Thema ist interessant genug für eine kleine Kritik:
Das Hauptproblem des Buches ist dasselbe wie bei anderen Büchern, die für sich den Anspruch stellen eine „Theorie für alles“ aufgestellt zu haben (z.B. Humor – Code, Tipping point, Anti-Fragality….): Die Theorie, dass ein Spiel Spaß macht, weil es das Gehirn Überlebensskills zu trainieren hilft ist einerseits zu allgemein und wenig erklärt (Warum „Lernen“ an sich nicht immer Spaß macht, wird nicht groß thematisiert) und ist andererseits aus meiner Sicht zu einseitig. Beim reduzieren der Spiele auf die unterliegenden formalen Systeme, wischt er alle möglichen anderen Ursachen für Spaß vom Tisch – so bietet aus seiner Sicht die pure Story des Spieles keinen Spaß; ich behaupte einmal es gibt genug Gegenbeispiele, z.B. die reinen Erzählspiele, bei denen es außer einer Geschichte kein übergeordnetes Spielziel gibt. Tatsächlich ist er der Auffassung, dass ja, Planetfall durchaus emotionalen „Punch“ hat, doch dieser nicht dem Einfluss des Spielers unterliegt, weil die Schlüsselszene gescriptet ist. Hier verennt sich Koster ein bisschen in der angestrebten Universalität seiner Theorie.
Die Stärke des Buches ist aber, dass Koster -im Gegensatz zu den oben genannten anderen Büchern – sich nicht darauf beschränkt seine Theorie nur auf alle möglichen Fällen anzuwenden, um die Gültigkeit zu betonen. Stattdessen schneidet er interessante Themen rund um den Komplex „Spaß und Spieldesign“ an und benutzt seine Theorie als Basis – was ja auch der Sinn einer Theorie ist. Hier wird es durchaus lesenswert! So leitet er von seiner Lernthese ab, dass das Gehirn auf einem bestimmten Niveau gefordert werden will: Nicht so schwer und nicht so leicht und er geht davon aus, dass daher die meisten Spieler Spiele bevorzugen, dessen Grundstruktur sie wiedererkennen, die aber neue Herausforderungen bieten. Insbesondere neigt man auch dazu, das gut zu finden, was einem irgendwo liegt – hiermit erklärt er auch die Genderunterschiede beim Spielegeschmack, aber diese Erklärung greift m.E. zu kurz und passt auch nicht so richtig ins Buch. Aus seinen Erkenntnissen wiederum baut er eine kleine Liste aus Dingen, die Spiele haben sollten, damit sie mehr oder überhaupt Spaß machen. Dazu gehören u.a. ein Feedback-System und die Möglichkeit aus Fehlern zu lernen und das Spiel quasi zu üben. Mir neu ist in diesem Zusamenhang das sogenannte „Mastery-Problem“, das besagt, dass Gute Spieler neigen, schwächere anzugreifen, statt gleich starke. Das ist frustrierend für die Schwächeren und auf lange Sicht nicht herausfordernd -und damit langweilig! – für die Stärkeren. Aus diesem Problem leiten sich natürlich die Aufholmechanismen ab, aber das Problem selbst war mir so nicht präsent. Das zumindest Spiele mit hoher Interaktion dieses Problem auf dem Schirm haben sollten, ergibt natürlich absolut Sinn. Insgesamt umfasst die Liste 11 Punkte und alle sind valide, wenn auch der eine oder andere Punkt bei Computerspielen vielleicht wichtiger ist als bei Brettspielen.
Sehr gelungen ist in meinen Augen auch das Kapitel über Kunst und Spiele und nicht nur, weil er im wesentlichen meiner Meinung ist :-) Hier erwähnt er, dass Kunstformen immer zwischen „stark formal“ und „extravagant“ schwingen, Spiele sich aber erst seit sehr kurzem aus dem formalen Bereich leicht wegbewegt haben. Er zeigt auch deutlich, dass Spiele dazu neigen, bekanntest einfach komplexer zu machen, statt anders (etwas was lange Zeit auch bei Brettspielen zu beobachten war, es hier jetzt aber dank der Internationalisierung auch viele Gegentrends gibt) und warum sich das jetzt sehr nach „Massenmarkt“ anfühlt und was damit überhaupt gemeint ist. Auch kritisiert er – wie Georgios – dass Spiele auf eine einzelne Emotion („Spaß“) festgelegt werden, wo andere Medien doch viel freier sind und damit auch mehr Möglichkeiten haben. Der Aspekt „Kunst und Spiel“ nimmt einen relativ großen Raum in dem Buch ein und wer sich so gar nicht für diesen Themenbereich begeistern kann, braucht dieses Buch auch nicht zu lesen.
Etwas unentschlossen bin ich beim Themengebiet „Story und Spiel“, dass immer wieder hochpoppt und nicht immer einheitlich, meiner Meinung nach. Die Kernthese, Spiele seinen formale Systeme und die Story nur der Deckmantel , der ohne System nicht funktioniert, ist mir zu wenig hilfreich. Er erklärt damit die Dissonanz bei ethischen Diskussionen („Nur ein Spiel“ vs „Überzogene Gewalt ist ein valider Kritikpunkt“) und auch bei anderen Überlegungen kann er überzeugen, aber die spieldesignaspekte sind nicht darunter.
Ohne Frage bietet das Buch viel Interessantes und viel Gesprächsstoff und einiges kann ich auch ohne Frage in dem einen oder andern Blogpost verwursten. Der gute Kern ist aber etwas verschüttet – Einleitung und der lange Epilog haben nichts zum Thema beizutragen, die Kernthese wird lange eingeführt um dann nicht vollends zu überzeugen. Zudem besteht jede zweite Seite aus einer kleinen Skizze und einem kurzen Statement, der mehr oder minder zum Text passt. Von den ca 240 Seiten sind also nur etwa 100 Seiten (ohne Register, Fussnoten) Lesestoff und davon etwa 60 wirklich gutes. Diese 60 Seiten würde ich jeden, der sich mit Spielen auch etwas intellektueller auseinandersetzen will, durchaus empfehlen. Aber diesen Directors Cut gibt es leider nicht.
- Jenseits des Tellerrandes: Delicious in Dungeon - 14. April 2024
- Zielführende Überlegungen - 24. März 2024
- Spaß is just a four letter word - 10. März 2024