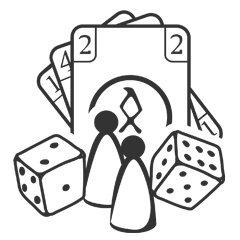Das Ulkige an einfachen Fragen ist meistens, dass ihre Antworten sehr verblüffend sein können. Zumindest wenn man nicht die erstbeste Idee, die einem in den Sinn kommt, für bare Münze nimmt. Nehmen wir eine einfache Frage wie: worum geht es in einem Spiel? Die erste Idee lautet vielleicht Spaß, Geselligkeit, Wettbewerb. Nun schleicht sich seit einigen Jahren ein weiterer Begriff in diese Reihe ein: das Thema. In einem Spiel geht es um das, was man sieht. Mehr noch, es geht um die Hintergründe und Zusammenhänge, welche durch das Gezeigte angedeutet werden. Es geht um die Dinge, auf die Spielbegriffe, Regelmechanismen und Illustrationen verweisen. Ein Spiel, so es denn mit ausreichend Anspruch und recherchierter Tiefe gemacht ist, handelt von dem Thema, welches es behandelt. Mit anderen Worten in einem guten, wertvollen Spiel geht es um (s)ein Thema.
Dieser Ansatz ist unter anderem deshalb so einladend, weil er das banale Spielen des Spiels hinter sich lassen kann und dazu einlädt lang und breit über andere Dinge zu sprechen. Seien es geschichtliche Hintergründe, seien es Fragen der Repräsentation oder sogar die Aussagen, die Autor*innen in ihren Werken treffen. Ich möchte hier nicht falsch verstanden werden: das sind legitime Dinge, über die man schreiben kann, wenn man ein Spiel als Sprungbrett nutzen will. Aber sie beziehen sich nur oberflächlich auf die Frage, worum es in dem Spiel geht. Man wählt diese Themen, wenn man eigentlich nicht über Spiele schreiben will, sondern das woran sie einen erinnern.
Über das Thema eines Spiels zu schreiben, muss aber nicht zwingend bedeuten, dass man nicht über das Spiel schreibt. Aber man muss sich dafür im Klaren sein wie das Thema am Tisch funktioniert. Denn hier steckt, gerade in den Spielen in die viel Recherche und gewissenhafte Beratung geflossen ist, viel spannendes.
Es beginnt alles mit einer etwas radikalen These: worum es in einem Spiel geht, wird erst in dem Moment bestimmt, im dem das Spiel gespielt wird.
Erst wenn wir das Spiel anfangen, ziehen wir die Verbindungen zwischen Mechanismen und Thema. Aus Pappmarkern wird Geld, Gold oder Florin. Aus Holzmarkern werden Arbeiter, Helden oder Kolonialmächte. In manchen Fällen wählen wir zusätzlich andere Begriffe, um die Spielinteraktion zu betiteln. Aus einem „leihen“ kann ein „stehlen“ werden. Aus einem „Spielstein entfernen“ kann ein „töten“ werden. Wir schreiben ganz instinktiv die Grundbausteine des Themas neu, wenn uns die durch das Spiel angebotenen Begriffe falsch erscheinen. Oder auch nur, wenn sie uns zu umständlich erscheinen.
Ein Spiel hat nicht ein fest gesetztes Thema, sondern lediglich ein Angebot, welches wir am Tisch nutzen, ändern und in extremen Fällen auch über Bord werfen können. Wie oft wird einem Spiel ein „raufgeklatschtes Thema“ attestiert, weil wir als Spieler*innen entschieden haben, dass uns das Themenangebot missfällt? Wie oft was es uns den gedanklichen Aufwand nicht wert, die Zusammenhänge zwischen Regeln und Thema zu ziehen; also haben wir uns nur auf die Regeln beschränkt?
Es hängt an uns, ob das Spiel das Thema hat, welches uns angeboten bzw. aufbereitet wurde. Ähnlich wie es auch an uns hängt, ob die Siegbedingung des Spiels für uns relevant ist oder nicht. Auch das ist kein Punkt, der vom Spiel vorgegeben wird. Diese Dynamik wird am deutlichsten, wenn wir ein Spiel spielen, welches nur eine/n Sieger*in erlaubt; aber während des Spielverlaufs Spieler*innen der Meinung sind, keine Chance auf den Sieg mehr zu besitzen. In diesen Momenten müssen sie ihrem Spielverhalten eine neue Zielbedingung geben. Vielleicht spielen sie auf die für sie beste, noch erreichbare Platzierung in der Endwertung. Vielleicht spielen sie darauf hin besser dazustehen als jemand anders am Tisch. (New Angeles machte aus diesem Reflex seine primäre Siegbedingung.) Vielleicht versuchen sie auch gezielt der Person zu schaden, die sie für diese Chancenlosigkeit verantwortlich machen. Diese Dinge werden in den meisten Fällen nicht per Regeln, aus dem Spiel oder unausgesprochen in der Gruppe, geklärt. Ein Spiel ist kein Stück Software, welches Spieler*innen auszuführen haben. Es ist ein Handlungsangebot, welches mit dem Versprechen gepaart wird, dass das resultierende Spielerlebnis positiv sein wird.
Als Spielgruppe entscheiden wir uns, diese Siegbedingung als wertvoll genug zu erachten, dass wir uns mental, sozial und auch emotional darauf einlassen. Es ist eine Entscheidung, welche die Grundlage für das spielerische Handeln liefert. Aus dieser gemeinsamen Entscheidung entsteht der magische Zirkel: wir behandeln die ausgedachte Siegbedingung des Spiels als hätte sie für unser reales Zusammensein Relevanz. Wer sich im modernen Wrestling etwas auskennt, wird diese Praxis unter einem anderen Namen kennen: Kayfabe. Vielleicht sollte man diesen Begriff auch in die Brettspiel-Szene übernehmen, da sie deutlich weniger verkopft klingt als „magischer Zirkel“.

Im Wrestling unterhält der Gebrauch von Kayfabe das Publikum ungemein. Nun kann man sich an überdramatisierten und hoch theatralischen Charakteren und Storylines erfreuen, statt sich „nur“ das Ringen mehrerer Athleten anzuschauen.
Am Spieltisch nun, ermöglicht Kayfabe, dass wir uns an mehr erfreuen können als an den Mechanismen selbst. Wir können diese durch thematische Bezüge und Verweise bereichern und so mehr Spielgenuss erschließen. (Am Rande: die Trennung von Mechanismen und Themen ist am Spieltisch eh mit Vorsicht zu genießen. Man kann diese als Spieler*in so umsetzen. Zwar beraubt man sich damit ein wenig des Spielerlebnis, aber oft ist die Reduktion des eigenen Blickes auf die Mechanismen ein guter Weg um effektiver zu spielen und Taktiken zu optimieren. Wenn wir uns nur darauf konzentrieren was eine Tat bewirkt, und ignorieren was sie darstellt, fällt es uns entsprechend einfacher z.B. die Sklaverei-Karte zu kaufen, um Umsatz zu generieren oder unsere Arbeiter zu opfern, um auf einer Punkteleiste voranzukommen.)
Das Kayfabe-Konzept ist aber auch dahingehend sehr erhellend, wenn wir zur Frage zurückkehren, worum es in einem Spiel geht. Denn Kayfabe ist – wie erwähnt – eine Erhöhung des Fiktiven in den Bereich des für die Realität relevanten. Das Thema eines Spiels bereichert unser Spielerlebnis. Es bietet uns eine Möglichkeit uns an mehr zu erfreuen als am Ringen um den Sieg und den von sportlichem Ehrgeiz gezeichneten Wettbewerb. Das Thema eines Spiels erlaubt es uns mit Fiktion zu spielen und uns gegenseitig oder alleine zu unterhalten.
Beim Spielen geht es um ein Spielerlebnis, welches auf verschiedene Weise Emotionen aus uns entlocken kann. Mit Hilfe eines Themas, insbesondere eines gut aufbereiteten, können wir dieses Spielerlebnis noch vergrößern. Das Thema ist ein mächtiges Werkzeug, um uns jenseits von Ehrgeiz und Geselligkeit in das Spiel einzubeziehen und dafür zu begeistern.
Dieses Werkzeug wird von uns Spieler*innen eingesetzt, wenn wir spielen und bestimmen worum es in dem Spiel geht. Es liegt in unserer Hand die Angebote, die das Spiel uns bietet, in die Praxis umzusetzen. Aber wie auch immer unsere Entscheidung ausfallen sollte, worum es in einem Spiel geht: es ist Kayfabe. Darum ist die Frage, was das Spiel (oder Autor*in) über das Thema aussagt, zu kurz gedacht. Sie setzt sich lediglich mit den eigenen Fantasievorstellungen auseinander.
Aber die Frage, wie diese Vorstellungen entstanden sind und warum sie im gemeinsamen Spiel genau diese Form annehmen, ist um ein vielfaches interessanter. Die spannendste Frage ist wie uns Spiele zu bestimmten Gedanken führen.
- [Buchbesprechung] „What Board Games Mean to Me“ - 21. April 2024
- Wie verwerflich ist es im Spiel zu ‚töten‘? - 7. April 2024
- „Ja, hat Spaß gemacht.“ - 17. März 2024