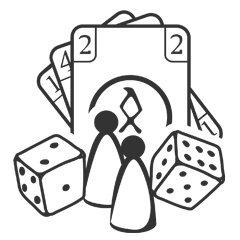Es mag den einen oder anderen überraschen, aber es macht mir keinen Spaß ein Spiel schlecht zu beurteilen oder gar zu zerreißen. Spätestens wenn man Spieleautoren persönlich kennen gelernt hat oder auch die Entwicklung eines Spiels vom Prototypen zum fertigen Produkt gesehen hat, geht ein vernichtendes Urteil nur schwer von der Hand. Aber nicht nur mir geht es so. Andere fahren auch oft ein hartes Urteil etwas herunter. So ist ein Spiel zum Beispiel “nicht ganz schlecht”, oder “für andere Gruppen bestimmt gut geeignet”, oder auch “nur für mich persönlich nicht so gelungen”. Eine solche Differenzierung machen zu wollen ist völlig menschlich und auch richtig. Spiele lassen sich nur selten in ein schlichtes Gut/Schlecht-Schema pressen.
Aber nur weil man feststellt, dass Dinge nicht nur schwarz oder weiß sind, heißt das ja noch lange nicht, dass es Schwarz und Weiß nicht gibt. Darum habe ich mal in verschiedenen Onlinekreisen und auch Offline-Runden die Frage in den Raum geworfen, was denn ein Spiel leisten muss, damit man es als schlecht bezeichnen würde.
Die Antworten waren unterschiedlichster Art. So galt für manche ein Spiel als schlecht, wenn man nur wenig Einflussnahme auf das Geschehen hatte. Noch schlimmer, wenn das noch mit langer Spieldauer verbunden war. Unverständliche Regelwerke, nicht intuitive Mechanismen oder umständliche Spielabläufe wurden erwähnt. Mit anderen Worten die Spielbarkeit war hier von großer Bedeutung. Damit ein Spiel schlecht sei, muss die Spielbarkeit vekorkst sein.
Andere Antworten stellten eher persönliche Erfahrungen in den Vordergrund: fehlender Spaß, übermäßig hoher Frustfaktor und ähnliches. Auch das war nachvollziehbar. Aber wer Spiele rezensiert, kann solche Kriterien natürlich nicht als Maßstab nehmen und erwarten ernst genommen zu werden. Ein Spiel haushoch zu verlieren und sich darüber zu ärgern, sollte nicht die Grundlage sein, weshalb man ein Spiel ablehnt. Von Vielspielern und Rezensenten erwartet man mehr.
Oft kamen aber auch ausweichende Antworten auf meine Frage. So zum Beispiel die Feststellung, dass Qualität relativ sei und das Urteil zu einem Spiel von den Erwartungen daran abhängt. Oder die Erkenntnis, dass Qualität subjektiv empfunden wird, und daher nicht für jeden Spielertyp benannt werden kann. Oder auch der Einwand, dass Qualität sich aus ganz vielen unterschiedlichen Punkten zusammensetzt. Diese Aussagen sind zwar alle inhaltlich zutreffend, aber schienen mir das eigentliche Thema zu verfehlen.
Schließlich steckt ja im Kern der Frage die Annahme, dass ein Urteil über ein Spiel nur dann fundiert sein kann, wenn es zumindest eine Grenze gibt, die ein Spiel zumindest theoretisch unterschreiten könnte. Wenn es kein schlechtes Spiel gibt, welchen Wert hat es dann ein anderes gut zu nennen?
Ich halte die Auseinandersetzung mit dieser Frage für durchaus wichtig. Zumindest wenn man sich die Mühe machen will Spiele qualitativ zu ordnen, um beispielsweise gute Rezensionen zu schreiben. Dabei geht es nicht darum die einzig wahre und richtige Grenze zu finden, die ein schlechtes Spiel von einem guten unterscheidet. Wenn es so etwas gäbe, dann bräuchte man kaum mehr als eine Hand voll Leute, die über das gesamte Hobby urteilen. Dann wäre Spielekritik nur wenig mehr als ein Benchmark-Test, den früher oder später auch eine Maschine ausüben könnte.
Aber eine gute Spielkritik ist eben mehr als das. Eine kritische Auseinandersetzung übersteigt das simple Wiedergeben der eigenen Spielerfahrung. Was man gespielt hat und wie es sich angefühlt hat, ist eben nur der Anfang. Eine gute Kritik analysiert das eigene Erlebnis und sucht die Gründe dafür. Sie benennt die Elemente des Spiels, die zu den Momenten führten, die für dieses Spiel typisch sind. Sie erkennt Ursache und Wirkung der einzelnen Bestandteile des Spiels und legt sie, wenn möglich, für alle offen. Vor allem aber, arbeitet sie darauf hin am Ende ein Urteil über all diese Dinge zu fällen. Ein Urteil, welches in seiner einfachsten, primitivsten und grundlegendsten Funktion nun einmal zwischen gut und schlecht unterscheiden muss. Genau das ist eben um ein Vielfaches schwieriger, wenn man eben nicht weiß, wo das Grau endet und das Schwarz beginnt.
- Wie verwerflich ist es im Spiel zu ‚töten‘? - 7. April 2024
- „Ja, hat Spaß gemacht.“ - 17. März 2024
- Verschwimmt die Grenze zwischen digital und analog? - 3. März 2024