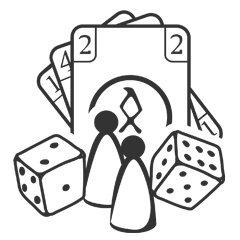Verlag: Ravensburger
Verlag: Ravensburger
Autoren: Inka und Martin Brand
Spieleranzahl: 3-5 (eigentlich nur für 5)
Alter: ab 9 Jahre
Spieldauer: 1-20 Minuten
Meine erste Partie Scotland Yard – Das Kartenspiel dauerte genau 2 Züge. Der dritte Spieler kam also nicht einmal an die Reihe, bevor das Spiel endete. Das ist eigentlich auch schon alles, was man über dieses Spiel wissen muss.
Nun ist aber dieses Kartenspiel eine gute Möglichkeit diverse Fragen zu diskutieren. Und solche Möglichkeiten lasse ich ungern ungenutzt!
Was erwartet man von einer Kartenspielversion eines Brettspieles eigentlich?
Es war mit Sicherheit keine leichte Aufgabe aus einem derart topologischen Spiel wie Scotland Yard ein Kartenspiel ohne Topologie zu machen! Die Brands haben das Problem gelöst, in dem sie ein Kartenanlegesystem á la 6 Nimmt verwendet haben. Je nachdem an welchem der drei Stapel eine Karte angelegt wird (und der Stapel, an den eine Karte gelegt werden muss, richtet sich im Wesentliche nach den 6-Nimmt-Regeln), kann eine andere Aktion durchgeführt werden. Hat die Karte eine bestimmte Farbe, wird eine stärkere Version dieser Aktion durchgeführt.
Abgesehen davon, dass die Karten sich graphisch an der Vorlage orientieren (und die drei Farben Taxigelb, Busgrün und U-Bahn-Rot sind) hat das natürlich nichts mit der Vorlage gemein.
Aber das ist in meinen Augen für eine Umsetzung in Ordnung. Eine Kartenspielversion muss sich nicht so spielen, wie die Brettspielversion, denn dann wäre eines der beiden obsolet. Mechanisch können die beiden Spiele durchaus unterschiedliche Wege gehen, wenn denn das Spielgefühl ähnlich ist.
Das Spielgefühl des Kartenspiels ähnelt nicht dem Spielgefühl der Vorlage.
Was macht das Original aus? Man weiß in etwa wo Mr. X ist und versucht ihn in eine Ecke zu treiben und zu stellen.
Im Kartenspiel weiß man erst einmal nicht wer Mr. X ist. Hat man dies mit einer der oben genannten Aktionen herausgefunden, so muss man ihm die Mr. X-Karte entziehen, in der Regel durch Aktion 3, die das Ziehen von Handkarten erlaubt. Diese kann man freilich auch durchführen, ohne dass man weiß, wer Mr. X ist. Das ist bei der Partie geschehen, die ich oben erwähnte.
Mr. X. kann mit schwarzen Zahlenkarten Sonderaktionen durchführen, inklusive dem zufälligen Abgeben der Mr.-X-Karte. Er gewinnt auch, wenn die Spieler keine Handkarten mehr haben oder der Nachschubstapel leer ist. Das ist so ein bisschen wie im Brettspiel.
Aber eben leider nur ein bisschen – wie gesagt ist das Spielgefühl ein völlig anderes. Es erinnert eher an Schwarzen Peter als an Scotland Yard, nur dass man versucht die schwarze Peter-Karte zu ziehen, statt sie zu vermeiden.
Die Dinge, die das Brettspiel ausmachen, die Topologie, das Einkesseln, das Katz-und-Mausspiel fehlen hier oder sind sehr abstrahiert. Tatsächlich ist die thematische Einkleidung fast kontraproduktiv, denn für Mr. X ist es vermutlich die beste Taktik, sich schnell zu erkennen zu geben und jemand anderem den schwarzen Peter zuzuschieben und dann als Detektiv zu gewinnen.
Ich denke, eine Kartenspielumsetzung sollte mehr bieten, als eine entsprechende Graphik. Wer ein Spiel gerade deswegen kauft, weil er das Original mag, wird enttäsucht, wenn das Original gar nicht vorkommt. Das heißt jetzt nicht, dass ich das besser hätte hinbekommen können – wie oben gesagt, war die gestellte Aufgabe sauschwer und die Brands haben durchaus einige gute Ideen entwickelt. Dass die nicht in jedem Fall zu einem interessanten Katz-und-Maus-Spiel führen liegt dabei auch an der bei günstigem Ziehen ultrakurzen Spieldauer.
Darf es denn die Möglichkeit geben, dass ein Spiel so schnell endet?
Es gibt einige Spiele, bei denen es durchaus zu schiefen Partien kommen kann, manchmal eben auch zu extrem kurzen Partien. So habe ich schon eine Siedler-Partie erlebt in der eine Stunde lang keine 6 gewürfelt wurde und ein Carcassonne-Zweierspiel, in der ein Spieler 10x hintereinander eine Straße gezogen hat und der andere ebenso oft keine Straße. In Civilization ist es theoretisch möglich, dass der Grieche im ersten Zug ein Schiff baut und dann den Rest der Partie zuguckt. Ist so etwas in Ordnung?
Die Frage ist eher: Wie aufwendig ist es, das zu verhindern? Und ist es den Aufwand wert?
Schiefe Partien können immer wieder vorkommen, insbesondere bei sehr zufallsbasierten Spielen. Schiefe Partien sind oft auch kein großes Problem, außer die erste Partie ist schief – dann kann das in dieser schnellebigen Zeit durchaus vorkommen, dass ein Spiel kein zweites Mal auf den Tisch kommt. Ist ein Spiel schnell zu Ende (so wie das Scotland Yard Kartenspiel) kann man allerdings natürlich auch einfach eine weitere Partie nachschieben. Die ist dann aber hoffentlich normal.
Aber warum sollte man schiefe Partien überhaupt hinnehmen? Kann da der Autor nicht irgendwas tun? Na sicher kann er! Nur: Gegen jede Ausnahmesituation gegenzusteuern kostet Regeln und mehr Regeln erhöhen die Einstiegshürde. Zudem sind Regeln, die dazu dienen, das Extremverteilungen vorkommen meistens sehr mechanisch-abstrakt. Da heißt es eben Abwägen, welchen Nachteil (mehr Regeln oder mehr schiefe Partien) man in Kauf nehmen will. Manchmal ist es auch gar nicht gewollt, hier einzugreifen: Manchmal will man den Spielern einfach alle Freiheiten lassen, inklusive der Freiheit, alles falsch zu machen (siehe Archipelago) und manchmal sind Extremverteilungen auch Bestandteil des „Zocks“ (siehe Catan), deren Beschneidung das Spiel vorhersehbarer und potentiell langweiliger macht.
Bei der oben erwähnten ersten Partie betrug die Chance, dass der zweite Spieler die Mr. X-Karte aus einer verdeckten Kartenhand zieht und das Spiel somit gewinnt 1:16. Ich denke nicht, dass es an dieser Stelle ein Problem mit den Regeln gibt. Es war schlichtweg enormes Glück.
Das Problem mit diesem Kartenspiel ist eher, dass wir recht häufig Partien hatten, die schlicht zu kurz waren, als dass es einen interessanten Spielverlauf gegeben hätte. Überspitzt formuliert ist es fast so, dass man Glück braucht, um einen interessanten Spielverlauf zu erleben. Das liegt zum Teil an den Regeln, die sicherlich per Vorgabe von Ravensburger nicht zu kompliziert sein durften. Zum Teil liegt es auch an der Spielerzahl: Zu dritt ist die Chance einen Zufallstreffer zu haben eben größer als zu fünft – und damit die Chance, dass das Spiel endet, bevor irgendetwas interessantes passiert (Das Spiel ist durchaus auf eine kurze Spieldauer angelegt – das ist also kein Nachteil per se – aber es ist durchaus darauf angelegt, dass Mr. X sich ein bisschen wehren kann, bevor er enttarnt wird).
Ist Ehrlichkeit bei Spielerzahlen kontraproduktiv?
Beim ursprünglichen Scotland Yard gibt es die Internettheorie, dass Scotland Yard eigentlich ein reines Zweipersonenspiel ist, das künstlich für mehr Spieler aufgeblasen wurde.
Das ist Unsinn: Ein guter Mr. X richtet seine Strategie nämlich auch nach dem aus, was die Spieler untereinander diskutieren und dieser Aspekt funktioniert zu zweit ja nun nicht.
Dennoch: Das Urspiel war offiziell für 3-6 Spieler, allerdings habe ich niemals erlebt, dass die Detektive zu dritt eine Chance gehabt hätten. Zu sechst war Mr. X stets chancenlos. 4-5 Spieler sind optimal.
Das Kartenspiel ist jetzt am ehesten zu fünft spielbar und das wirft die Frage auf, warum man überhaupt die 3 bei der Spielerzahl zugelassen hat. Wer sich ein Kartenspiel kauft, weil er zu dritt gerne Kartenspiele kauft, wird dem Scotland Yard Kartenspiel nicht positiv gegenüber gestimmt sein. Natürlich: Es geht. Zu zweit kann man auch Skat spielen und zu dritt Geber-Schach. Das heißt nicht, dass es sinnvoll ist. Die Spielerzahlen also in Bereichen anzugeben, die man besser vermeidet, sorgt potentiell für Käuferfrust und negative Amazon-Rezensionen.
Nur wollen Verlage aus gutem Grund eine möglichst große Spannbreite von Spielerzahlen auf die Schachtel drucken. Denn Spiele mit eingeschränkter Spieleranzahl verkaufen sich potentiell schlechter. Man denke z.B. an das geniale Witness, für das man exakt 4 Spieler braucht, was in den einschlägigen Internetseiten durchaus diskutiert und kritisiert wurde (ein anderes Beispiel war das alte Verrat, das ebenfalls nur genau für vier Spieler war und ebenso schnell aus den Läden verschwand).
Der Kompromiss, suboptimale Spielerzahlen auf der Schachtel eingeklammert anzugeben ist kein wirklicher, denn ‑Hand aufs Herz‑ jeder Käufer wird eine Angabe „4 (3)“ als reine 4-Spieler-Angabe behandeln.
Die Alternative sind Sonderregeln für verschiedene Mitspielerzahlen, die dafür sorgen, dass es auch mit sonst weniger geeigneten Spielerzahlen läuft. Doch das sind wieder mehr Regeln. Und es ist auch nicht immer möglich.
Die Verlage können also prinzipiell machen was sie wollen – sie liegen eh falsch.
Wie kann ein Spiel „Tabletalk“ fördern?
Mit etwas gutem Willen kann man das Scotland Yard Kartenspiel als „Social Deduction Game“ bezeichnen, da man ja zumindest in der Anfangsphase Mr. X suchen muss (außer der spielt offensiv auf „Mr-X-Sein-Vermeidung“). Social Deduction Games leben oft von den gegenseitigen Beschuldigungen und den Interpretationen der einzelnen Handlungen. Das Grundspiel lebte von Diskussionen unter den Detektiven über das richtige Vorgehen.
Da ist es ein wenig überraschend, dass das Kartenspiel zumindest in den ersten Partien recht wenig „Tabletalk“ bietet. Partiell ist dies der kurzen Spieldauer geschuldet. Zum Teil liegt es aber auch daran, dass das Spiel die Diskussionsmöglichkeiten nicht offensiv nach außen transportiert. Ein Spieler, der das Spiel schon durchschaut hat, kann durchaus darauf hinweisen, dass bestimmte Karten eine Aktion blockieren (weil es keine Zahlen mehr gibt, die dort angelegt werden würden) oder ermöglichen (weil der nächsthöhere Stapel wieder eine deutlich höhere Zahl bekommen hat). Tatsächlich ist das System clever und kann subtil genutzt werden und bietet genau die richtige Mischung aus „Taktisches Spiel möglich“ und „Manchmal kann man nicht anders, als eine schlechte Karte anlegen, obwohl man gar nicht Mr. X ist“. Das Problem: Das kann man erst erkennen, wenn man das System verstanden hat. Und selbst dann ist es doch etwas abstrakt – jedenfalls deutlich abstrakter als etwa bei Tempel des Schreckens, bei dem genau jene Beschuldigungen im Vordergrund stehen und die sich fast von selbst ergeben.
Wie hätte die Diskussionen gefördert werden können? Zumindest hätte dieser Aspekt in der Spielanleitung hervorgehoben werden müssen. Generell entdeckt man die taktischen Feinheiten, die das Spiel durchaus bietet (wenn auch in sehr niedriger Dosierung) erst nach und nach. Das Kartenziehglück steht dagegen sehr prominent im Vordergrund und daher wird auch gerne übersehen, dass Mr. X durchaus gezielt einen Stapel blockiert haben könnte. Dann bleibt aber für Diskussionen nicht mehr genügend Grundlage.
Davon abgesehen passt auch „wildes Beschuldigen“ nicht zum Thema – anders als z.B. bei Tempel des Schreckens. Hier steht sich die Marke ein wenig selbst im Wege. Die zufallsbasiert gekürzte Spieldauer tut dann ihr Übriges.
- Jenseits des Tellerrandes: Delicious in Dungeon - 14. April 2024
- Zielführende Überlegungen - 24. März 2024
- Spaß is just a four letter word - 10. März 2024