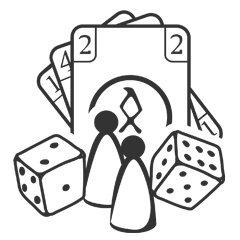Verlag: Helvetiq
Autor: Mitsuo Yamamoto
Spieleranzahl: 2-3
Alter: ab 8 Jahren
Spieldauer: 10-20 Minuten
Normalerweise sollten abstrakte Zweipersonenspiele so angelegt sein, dass sie schnell zu erfassen sind und sich die Spieler so auf die Strategien konzentrieren können. Spiele dieses Genres bei denen nicht der bessere Stratege gewinnt, sondern derjenige, der weniger Fehler macht, sind frustrierend. Und Spiele werden nicht strategischer wenn sie künstlich Usability-Probleme erzeugen, die es den Spielern schwerer machen, das Spiel zu spielen. Mein Lieblingsbeispiel ist da immer Cirondo, bei dem der Spielplan nur deswegen so aussieht wie eine Spirale (Eigentlich eine Fraser-Spirale), damit die wichtigen Diagonalen nicht so leicht erkannt werden und man nicht merkt, dass das eigentliche Spiel sehr simpel und unaufregend ist.
Four Senses lacht diesem Credo ins Gesicht: Das ganze Design ist einzig darauf angelegt, es den Spielern schwerer zu machen, das Spielbrett zu erfassen.
Wer die Spieler bei einer Partie Four Senses ausblendet, sieht ein recht herkömmliches abstraktes Spiel: Es gibt drei Arten von Steinen, jeder kann jede Sorte einsetzen. Ziel ist es vier gleiche Steine in eine Reihe zu bekommen oder Steine so nach festen Regeln zu stapeln, dass entweder eine Treppe aus drei Steinen oder eine gleich hohe Reihe aus vier Steinen entsteht. Primäres Ziel ist es, dem Nachfolger keine Vorlage zu geben – aktiv auf den Sieg zu spielen ist unmöglich, da man keinerlei Einfluss auf den Zug des Gegners hat. Würde man Four Senses so spielen, wie andere abstrakte Zweier, wäre es kein Spiel, mit dem ich mich kaum länger als nötig befasst hätte.
Nur spielt man Four Senses nicht wie andere abstrakte Zweier, sondern blind: Alle Spieler bekommen beim Spielen ihre Augen verbunden. Was ändert das? Alles. Und nichts.
Um die Spielsituation erfassen zu können, muss man sich auf seinen Tastsinn verlassen: leere Felder und die Steine fühlen sich unterschiedlich an, die Höhe kann -und muss- ebenfalls erfühlt werden. Das ändert den ganzen Fokus des Spieles: Statt strategisch zu denken, gilt es jetzt daran, sich das Spielbrett gut genug vorstellen zu können, dass man eben jene Vorlagen von anderen auch erkennt und selbst vermeidet. Das „Fehler vermeiden“ ist jetzt Spielprinzip, wird aber als „Spielerlebnis“ wahrgenommen, ja ist der „selling point“ von Four Senses.
Allerdings ist dieses Erlebnis darauf beschränkt, Steine in einem Brett zu erfühlen statt sie sich anzusehen. Das ist eine Variante, ja, aber hier wird mit der Blindheit nichts neues addiert. Damit wirft es in dieser Hinsicht deutlich kürzer als ein Nacht der Magier, bei dem der Großteil der Bäume unbekannt ist oder das konsequentere Arabian Pots, bei dem ebenfalls Gewinnstellungen erreicht werden sollen, die Figuren aber am Gehör erkannt werden müssen – was deutlich schwieriger ist als die Fühlaufgabe bei Four Senses (und zudem kommt ein Merk-Mechanismus zum Tragen, da man nur ziehen oder schütteln darf). Das sicherlich unperfekte Nyctophobia macht die Dunkelheit sogar vollends zum Erlebnis, weil nur die unmittelbare Umgebung der Spieler bekannt ist. Four senses dagegen schränkt lediglich die Sicht ein, aber die Informationen nicht – Theoretisch kann beliebig lange gefühlt werden, so dass der Plan irgendwann ausreichend erkannt sein sollte. Gerade am Anfang einer Partie ist die Ausgangslage sehr klar zu erfassen. Wenn sich die Spieler nicht gerade darauf konzentrieren, möglichst chaotische Zustände aufzubauen (in der Hoffnung, der Gegner liest das Brett falsch), wird das Spiel niemals den Grad Komplexität erreichen, den etwa blinde Schachspieler beherrschen.
Und genau das ist vielleicht der eigentliche Zweck bei Four Senses: Es geht hier weniger darum, einem Spielerlebnis eine neue Dimension abzugewinnen oder einen neuartigen Mechanismus vorzustellen – sondern es geht einzig und allein um den Perspektivwechsel: Wie erfährt eine sehbehinderte Person ein Spiel? In dieser Interpretation macht es Sinn, dass der Mechanismus keine weitere Tiefe erzeugt, weil es nicht darum geht, eine zusätzliche Tiefe zu erzeugen. Genau genommen geht es nicht einmal um das Spiel selbst. Es geht einzig darum, die normale Alltagserfahrung einer Minderheit abzubilden, etwas dass durchaus sehr viel wertvoller sein kann, als das Mattsetzen eines Königs.
- Jenseits des Tellerrandes: Delicious in Dungeon - 14. April 2024
- Zielführende Überlegungen - 24. März 2024
- Spaß is just a four letter word - 10. März 2024